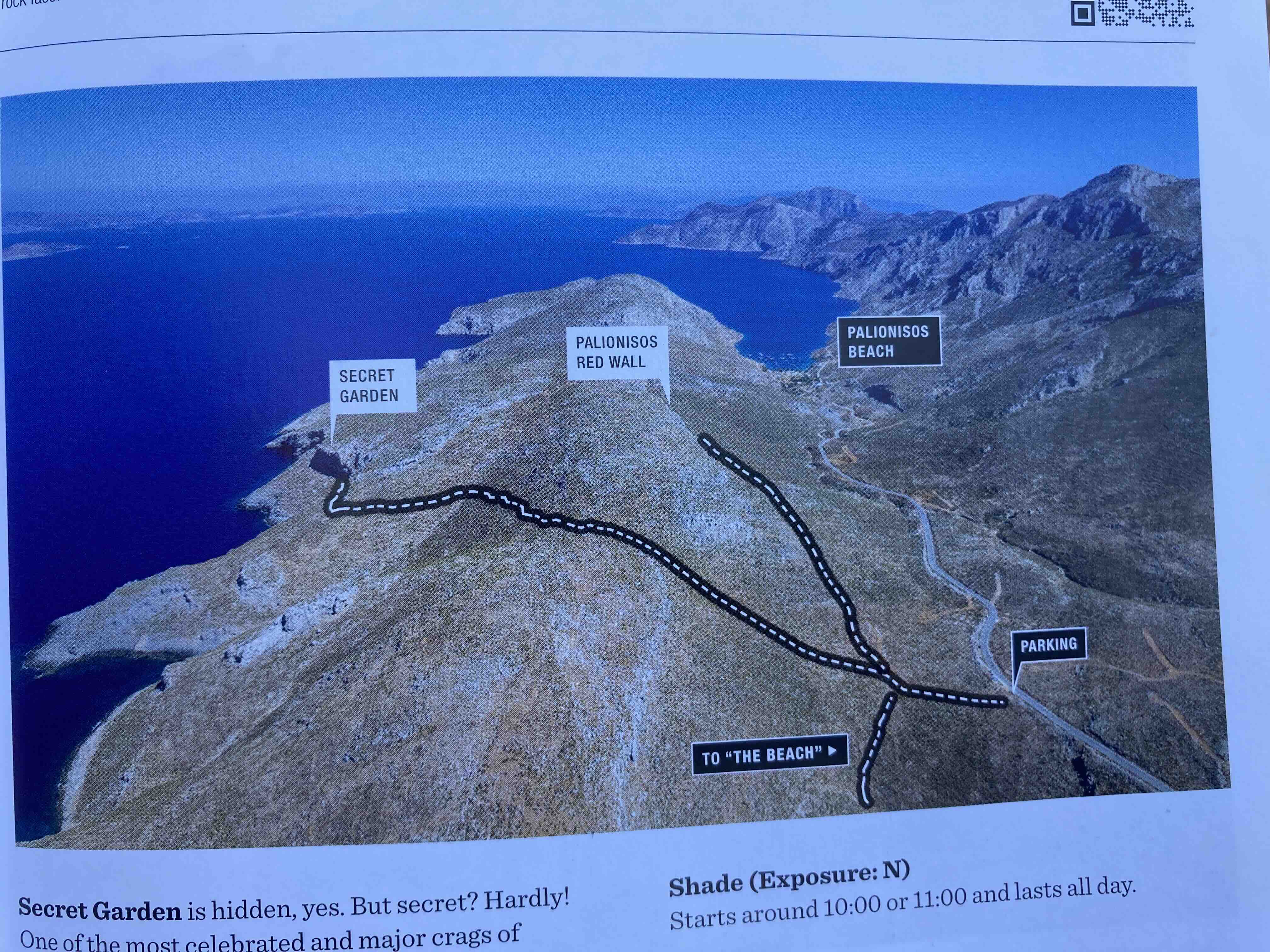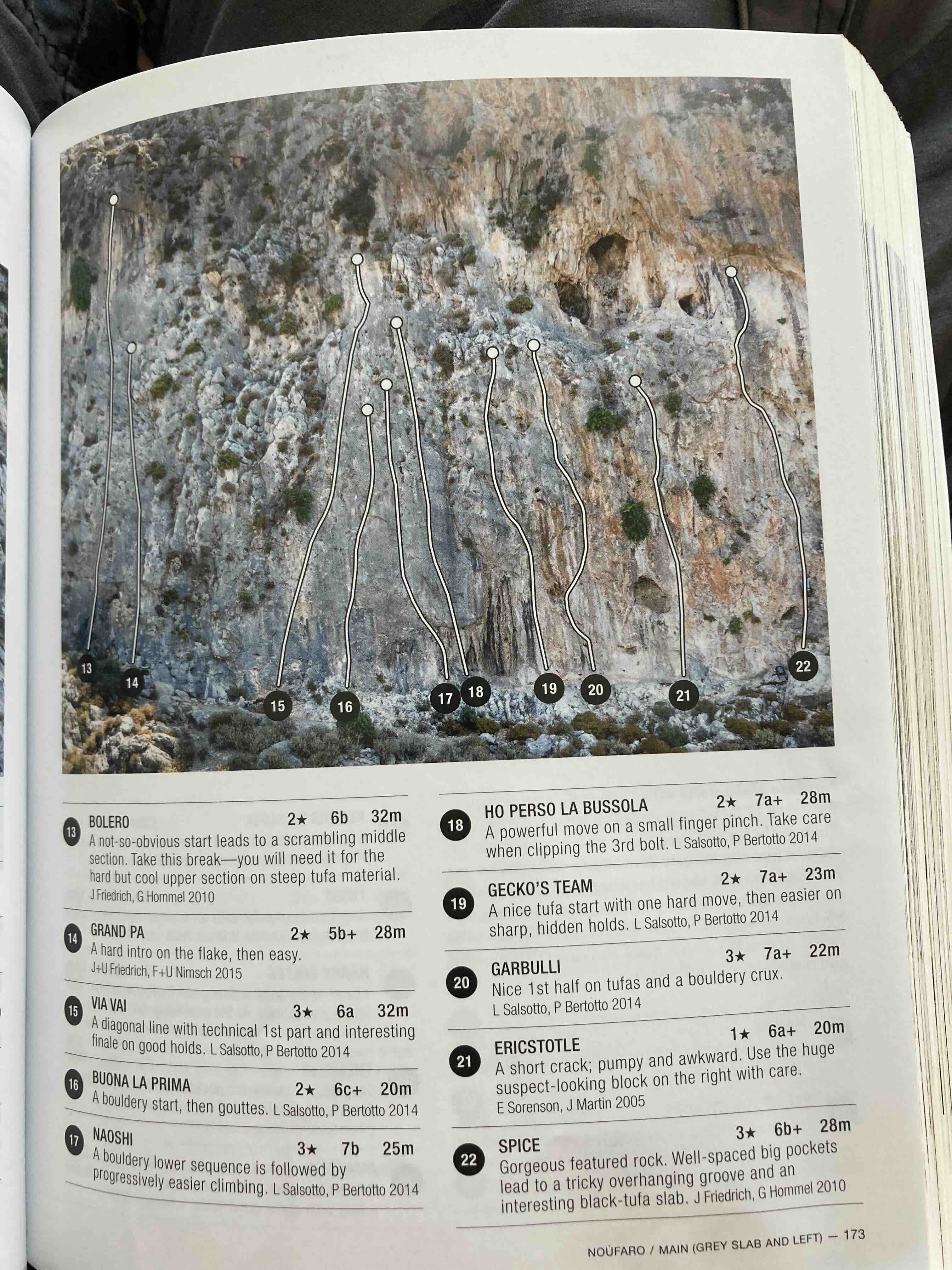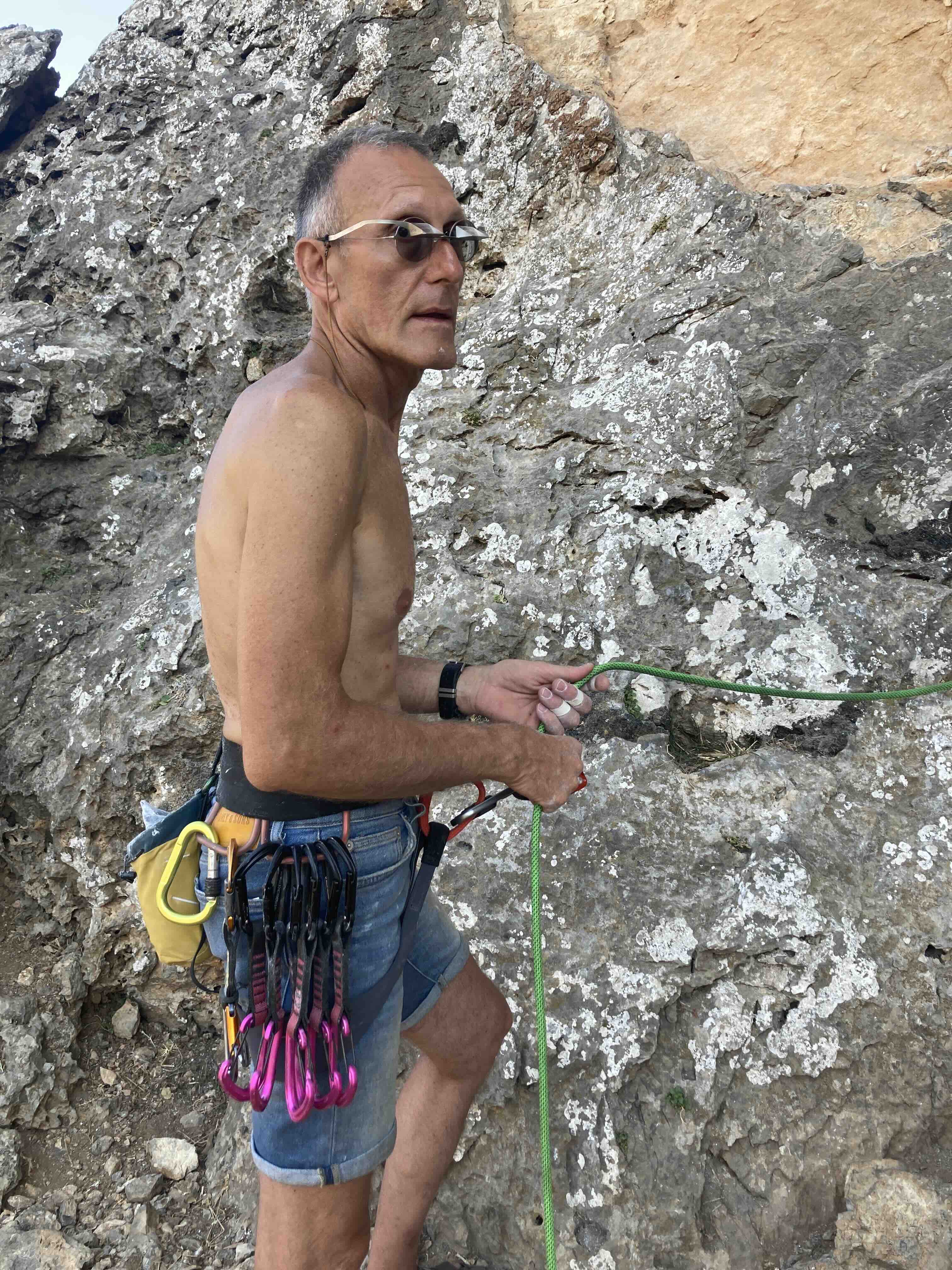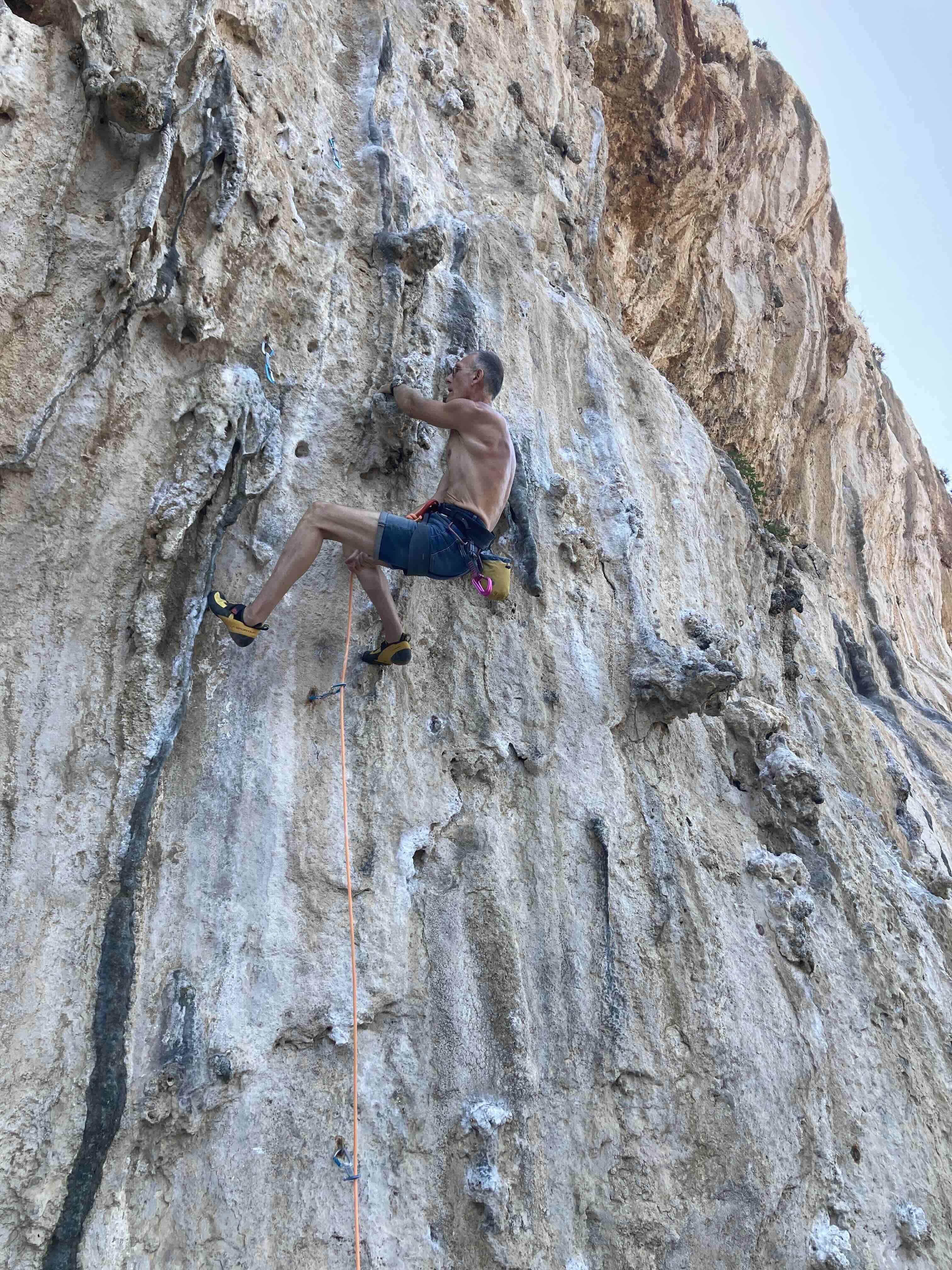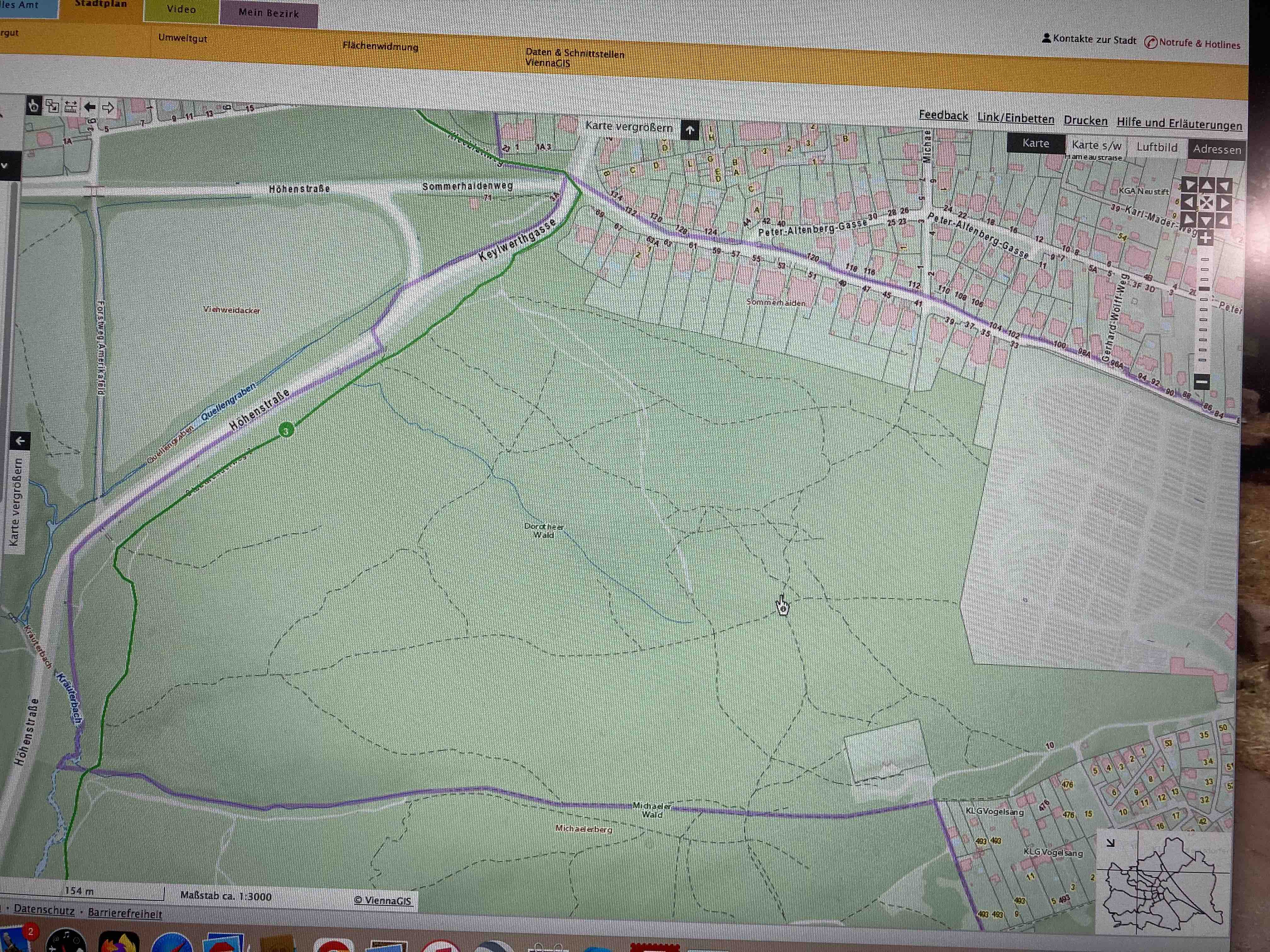Niki möchte gerne tauchen lernen. Er wird in seinem Leben wahrscheinlich nie ein Korallenriff sehen.
Niki ist mein Neffe, derzeit gerade fünf Jahre alt. Ab dem Alter von zwölf Jahren ist es möglich den Tauchschein zu machen. Das wird zu spät sein um noch irgendetwas von der Pracht zu erleben, die ich erleben durfte.
Um das verständlich zu machen, muss ich von der Reise schildern, von der ich gerade zurückgekommen bin.
Davor ein paar Fakten: 1993 habe ich in Sri Lanka (genauer: Poseidon Tauchbasis in Hikkaduwa, Lehrer Hannes Hantl) den PADI Open Water gemacht und seither ca. 350 Tauchgänge erleben dürfen.
Am Roten Meer war ich das erste Mal im Februar 2000, genauer: in einem Hotel in Mangroove Bay in El Quseir, gemeinsam mit meinem alten Freund Martin Heigl. Tauchgänge fast alle am Hausriff, einige wenige mit dem Zodiac ein Stück hinaus.
Ich erinnere mich an fantastische Tauchgänge an einem Riff, das damals schon nur mehr ein Schatten seiner eigenen Pracht war, und trotzdem noch schön, vor allem wenn man es nie in seiner Urform gesehen hat, die etwa bis in die 1960er-Jahre gedauert hat.
Danach folgten viele Tauchsafaris, manchmal jedes Jahr, dann wieder mit einigen Jahren Pause. Die letzte war im Februar 2020, kurz vor Corona, die Erfüllung eines alten Traums: Tauchen im Sudan.
Das war zwar nett, mein Haupteindruck war allerdings auch die Enttäuschung, wie kaputt die Riffe dort schon waren. Ich erhoffte mir doch einen deutlichen Unterschied zu Ägypten, weil es im Sudan 1.) viel weniger Betauchung gibt und 2.) keine Ressorts, die seit immer schon ihre gesamten Abwässer durch Rohre ins Meer leiten.
Ich konnte allerdings keinen Unterschied zu Ägypten feststellen. Viele tote Korallenstöcke, reduzierte Vielfalt und Menge bei der Unterwasserfauna, aber noch fast keine Korallenbleiche.
Diesmal war das anders. Sehr anders, zu meinem Erschrecken.
Beginnen wir beim Anfang der Reise. (Wer das nicht alles lesen will – ich habe immer wieder kleine Überschriften eingebaut, zu denen man hinscrollen kann. Ich beschreibe alles so ausführlich, weil es für mich auch als Erinnerung gedacht ist.)
Die Anreise
Beim Taxifahrer stellt sich heraus, dass er aus Ägypten ist. Irgendwie passend, kosten tut der Spaß 39 Euro und einchecken muss man beim A1-Terminal, für die Billigfluglinien. Die vorausgesagte Strenge („20 kg und kein Gramm mehr“) stellt sich als dehnbar heraus, was praktisch ist, weil mein Tauchtrolley leider leer schon zu schwer ist. Übrigens lässt sich schummeln, wenn notwendig, weil man das große Tauchgepäck nach dem Einchecken ggü. beim Großgepäckschalter abgeben muss. Dort wird es aber nicht mehr gewogen. Wer also Dringlichkeit hat, kann noch das eine oder andere Kilo reinpacken.
Ansonsten verläuft alles erfreulich, wir bekommen Fenster- und Gangplatz und die Dame am Schalter meint, den Mittelplatz würden sie nicht mehr vergeben. Sehr angenehm, weil die Air Cairo hat unfassbar enge Sitzabstände:

Bild: Ich sitze aufrecht, so weit hinten wie möglich, trotzdem stoße ich mit den Knien am Vordersitz an.
Inzwischen ist mir Fliegen nicht nur unangenehm, ich hasse es geradezu. Leider lassen sich sehr viele Orte ohne Flugzeug einfach nicht erreichen. Mein Ziel ist es in Zukunft möglichst wenig zu fliegen. Die letzten Jahre waren das maximal zwei Flüge pro Jahr. Das sollte noch weniger werden, nicht nur aus Umweltschutzgründen.
Vor dem Einsteigen geht es aber noch durch die diversen Kontrollen, bei der Sicherheitsschleuse werde ich auf Sprengstoff abgetupft und jede einzelne Batterie für meine Tauchlampen auch.
In der Hektik lasse ich meinen Gürtel liegen, komme aber erst zu spät drauf. Pech gehabt.
Sehr mühsam finde ich die Schlangenlinien, die man durch die Duty-Free-Shops machen muss, Konsumindustrie sei Dank. Dafür kann man in Schwechat, wenn man eine leere Wasserflasche mitgenommen hat, diese im Abflugbereich anfüllen. Das empfehle ich vor allem für die AirCairo, weil dort bekommt jeder Gast genau einen Becher Wasser für den gesamten Flug von vier Stunden. Wer mehr will, muss ordentlich in die Tasche greifen, derzeit kostet eine kleine Flasche 3,50 Euro.
Der unangenehmste Teil dieser Reise erfolgt dann am Weg zum Flugzeug. Irgendwer koordiniert schlecht und wir müssen fast 20 Minuten im gerammelt vollen Zubringerbus auf das Einsteigen warten. Dabei knallt mir die Klimaanlage direkt ins Genick und auf den Kopf. Ausweichen unmöglich.

Bild: Abendstimmung beim Flug. Beeindruckend, aber auch erschreckend war der Flug über Kairo, der dauerte gefühltermaßen ewig, so groß ist diese Stadt.
Der Flug selbst verläuft unspektakulär, die Einreise in Marsa Alam ist es ebenso, wir sind nach nicht einmal zehn Minuten draußen, sie sind dort freundlich und ziemlich unbürokratisch. Der Großteil der Touristen ist von der Sorte, die nach der Landung klatscht und dann für eine Woche an den Hotelpool verschwindet.
Das Taxi bringt uns zum Hotel „PickAlbatros“, genauer zu einem der Hotels, die haben mehrere nebeneinander. An der Rezeption finden sie unsere Buchung nicht, was etwas nervig ist, denn es geht auf 23 Uhr zu und wir sind müde. Dann die Nachricht, dass sie uns ein „Upgrade“ in ein anderes Hotel geben. Dort angekommen stellt sich heraus, dass das Zimmer nur ein Doppelbett hat (mit nur einer Decke), was meinen Bruder etwas auf die Palme bringt.
Sie versprechen uns ein Einzelbett hineinzustellen und ich bin den Hotelbesuch jetzt schon leid. Es gibt sogar noch ein wenig Abendessen für uns und auch die Klimaanlage lässt sich abstellen.
Wir sind auf Nummer sicher gegangen und schon am Mittwoch geflogen, obwohl wir erst am Donnerstag aufs Schiff gehen.
Die Nacht ist leider schrecklich, die vielen Klimaanlagen machen sich bemerkbar, meine Nase ist zu und weil wir das Fenster offen lassen müssen, quälen die lärmenden Gäste draußen.
Das Frühstück ist üppig, sehr üppig sogar, so dass jeder wirklich alles findet, was das Herz begehrt. Da bleibt kein Wunsch offen, leider entsteht dadurch auch eine immense Verschwendung an Lebensmitteln, was ich wiederum nicht so toll finde. Etwas weniger würde auch reichen, aber die Touristen wollen in ihrem Urlaub gerne verschwenderisch sein, den Überfluss genießen, den sie möglicherweise daheim nicht haben.

Bild: Ein Teil des Süßigkeitenbuffets.
Es ist nicht nur der Überfluss, es ist auch die sagenhafte Ressourcenverschwendung. Plastik, Metall – der Müll landet in Ägypten im Meer oder hinter der nächsten Düne. Wer das nicht glaubt, braucht nur hundert Meter jenseits der Küstenstraße hinter den nächsten Hügel zu schauen oder auf eine der flachen Inseln im Nordteil des Roten Meeres zu gehen. Die bestehen fast nur mehr aus Plastikabfall.

Bild: Die winzige Butterportion, unglaublich aufwändig verpackt. Nach drei Sekunden Gebrauch ist sie Müll, der zu 100% nicht wiederverwertet wird, zumindest in Ägypten.
Nach einer mühsamen Wartezeit (ich finde Warten generell mühsam, besonders aber bei Reisen) kommt das Taxi, um uns zum Schiff zu bringen.
Das Schiff

Bild: Unser Schiff
Die Golden Dolphin IV ist das neueste, größte und schönste Schiff der Flotte. Es hat ca. 10 Mio Euro gekostet, ist ein Stahlschiff und speziell für Tauchsafaris gebaut.
46 Meter Länge, fünf Decks, 2 Cummins-Dieselmotoren mit je 1.500 PS, ein Gewicht von 420 Tonnen, 3 Generatoren und eine extrem leistungsstarke Kompressoranlage zum Befüllen der Tauchflaschen. Es ist Platz für 28 Gäste und ca. 20 Mann Crew.
Das Schiff ist erst in seinem dritten Jahr auf See und das merkt man – alles ist noch fast wie neu.
Der Whirlpool am Oberdeck sieht am Prospekt gut aus, wird aber fast nie verwendet. Bei der Fahrt muss er sowieso ausgelassen werden und auch das Bild, das ich habe machen lassen, ist ein Fake: Das Wasser war kalt, die Bierdose habe ich nie geöffnet (alkoholfreie Woche an Bord) und die Sonnenbrille war sinnlos, dahinter sieht man den letzten Rest der Abenddämmerung, es war schon recht dunkel.

Bild: Guido macht auf lässig im Whirlpool. Ein Fake
Kein Fake ist die hervorragende und perfekt aufs Tauchen abgestimmte Ausstattung des Schiffs. Das beginnt bei der Sicherheit (Sauerstoffflaschen, Feuerlöscher etc.) und geht bis zur Füllung der Flaschen, die pro Flasche nur ca. 1,5 Minuten dauert. Platz ist sowieso überall reichlich vorhanden, die Kabinen sind kleine Hotelzimmer, jedes mit einem Bad und WC ausgestattet.
Als mein Bruder Peter und ich an Bord kommen – wir sind bis auf Tatjana die ersten Gäste, weil schon zu Mittag da – bekommen wir eine Kabine ganz unten zugeteilt. Die war zwar sehr schön, liegt aber etwas über der Wasserlinie und hat daher keine Fenster, die man öffnen kann. Daher braucht man die Aircondition, was für mich, vor allem aber für Peter eigentlich nicht in Frage kommt.
Nun haben wir das Problem, dass die Kabinen ja schon im Vorfeld zugewiesen werden. Wir hatten vergessen einen entsprechenden Wunsch zu äußern, weil wir das Schiff ja nicht kannten und die Sache mit den verschlossenen Fenstern nicht wussten.
Die Lösung wäre eine Kabine ein Deck weiter oben, weil dort gibt es Fenster, die man öffnen kann und somit keine Klimaanlage braucht.
Also müssen wir versuchen, schnell eine Lösung zu finden. Wir bitten einen der Boys (von der Mannschaft ist noch niemand da und die Guides auch nicht) im Büro anzurufen. Am Telefon haben wir dann Hazem, der sich als einer der Guides vorstellt und meint, er würde schauen, was sich machen lässt.
Ein paar Minuten später kommt der Rückruf: zwei Gäste wären bereit mit uns zu tauschen. Wir sind dankbar und happy, dass unser Problem gelöst werden konnte.
Ich war in den letzten zwanzig Jahren schon auf der Golden Dolphin 1, 2 und 3. Alles wunderbare und gut ausgestattete Tauchschiffe, kein einziges reicht aber an die 4er heran.

Bild: Längenvergleich zwischen der Golden Dolphin 3 links und der Golden Dolphin 4 rechts. Die 4er hat auch ein Deck mehr.

Bild: Peter im Briefingraum. Er wird auch zwischen den Tauchgängen zum Entspannen genützt, manch einer sieht sich Tauchdokus am riesigen Fernseher an und es gibt rund um die Uhr frisches Obst und Kekse zur freien Entnahme. Gut zu sehen sind auch die Taschentuchboxen, die am ganzen Schiff verteilt sind und reichlich genützt werden, vor allem von denen, die gerade einen Schnupfen zu bekämpfen haben.
Vor zehn Jahren fuhren ca. 70 Safarischiffe am Roten Meer, heute sind es ca. 115. Die verschiedenen Krisen wie instabile politische Lage oder Corona haben dem Tourismus wenig bis gar nicht geschadet. Ich wage trotzdem eine Prognose: In zehn Jahren fahren hier nur mehr zehn Prozent der Schiffe. Auf die Gründe gehe ich später noch genauer ein.
Die älteren, kleineren Safarischiffe wurden tw. irgendwohin verkauft, etwa in den Oman oder nach Eritrea, einige fahren heute als Tagesboote herum und bringen Schnorchler und Taucher zu den diversen Riffen nahe der Küste. Es ist wie bei den Autos: alles wird immer größer, luxuriöser, bequemer, aber auch umweltzerstörender. Das gilt für die Safarischiffe ganz besonders, denn sie brauchen bei mehr Größe deutlich mehr Treibstoff.
Gut kann man die Entwicklung an den Zodiacs erkennen – jedes Safarischiff hat zwei davon, sie werden bei fast jedem Tauchgang gebraucht um die Taucher zum Einstieg zu bringen bzw. aufzusammeln, wenn sie es nicht bis zum Schiff zurück schaffen.
Die neueste Entwicklung sind Zodiacs mit Steuerstand und Einstiegsleiter – manche haben sogar zwei davon, was ein wenig übertrieben erscheint. Wahrscheinlich hat ein Safariboot damit begonnen und alle anderen sind nachgezogen. Das ist durchaus eine erfreuliche Entwicklung, weil das Einsteigen vor allem bei Wellengang war immer ein unwürdiges Schauspiel. Jetzt ist das wesentlich einfacher.

Bild: Bereit um zum Tauchplatz zu fahren. Die Einstiegsleiter ist gut sichtbar, das Lenkrad halb verdeckt.
Der Umweltaspekt spielt genau genommen an jeder Ecke eine Rolle. Ein Beispiel ist das Wasser. Die großen Schiffe haben einen Watermaker an Bord, der macht aus Meerwasser Süßwasser, braucht dafür aber jede Menge Energie, die wiederum aus dem Dieseltreibstoff über die Generatoren erzeugt wird. Früher musste man noch Wasser sparen, heute bekommt man den Komfort so lange und so oft duschen zu können wie man will.
Unsere Guides haben zwar betont, dass wir das möglichst nicht tun sollen, also ein kurzes Abspülen nach jedem Tauchgang und am Abend eine normale Dusche schon, aber nicht eine halbe Stunde 4x am Tag oder so.
Das wurde auch beherzigt, erscheint mir aber als Tropfen auf den heißen Stein.
Generell sind die Gäste gewissen Umweltschutzvorgaben durchaus zugänglich – es gibt z.B. zwar Plastikwasserflaschen an Bord, wir wurden aber gebeten, mit möglichst wenig davon auszukommen. Dafür gibt es an jeder Ecke die großen Wasserspender, aus denen man noch dazu gekühltes Trinkwasser in Becher oder eben eigene Plastikflaschen abfüllen kann. Aber auch die Wasserspender brauchen Strom und das Wasser muss in großen Mengen mit dem LKW herbeigeschafft werden. Dazu kommt die Fabrik, in der die großen Behälter befüllt werden etc.
In den Hotels ist der Ressourcenaufwand für das Wasser noch höher, denn es gibt dort – wir befinden uns in der Wüste – kein Süßwasser, es muss alles aus Meerwasser erzeugt werden.
Das führt in Ägypten so weit, dass es mitten in der Wüste Golfplätze gibt (z.B. bei El Gouna), die mit Spezialgras bepflanzt werden, das einen gewissen Restsalzgehalt im Wasser aushält.
Weil manche Menschen sich einbilden mitten in der Wüste Golf spielen zu müssen. So wie manche in Dubai Skifahren. Umweltmäßig ein Irrsinn, aber wenn man den Preis dafür nicht zahlen muss, ist es halt egal.

Bild: Das Hauptdeck mit einer Bar. Dort gibt es eine Kaffeemaschine, einen Wasserkocher, Gläser, Kühlschränke und noch einiges mehr. Alle können sich rund um die Uhr dort bedienen. Tee und Kaffee wurden auch ständig getrunken, noch vor dem Early-Morning-Dive und bis zum Schlafengehen. Rechts sieht man die Wasserbehälter für die Spender. Nervig die Türe in den Briefing-Raum, die immer geschlossen gehalten werden muss. Jeder, der raus- oder reingeht, muss sie mit einem Schnapperl verschließen, das ist echt mühsam. Der Grund: Dahinter beginnt die Arktis, denn der Raum wird runtergekühlt bis zur Gefriergrenze, so wie auch der Speisesaal, die Gänge und die Kabinen. Argumentiert wird das mit der Notwendigkeit Schimmel und Kondenswasser zu vermeiden plus dem Wunsch mancher Gäste, kühle Räume zu haben. Draußen hatte es ja 30 Grad, wobei wir hier von Oktober sprechen, im Sommer hat es hier 40 Grad oder mehr.

Bild: Das große Tauchdeck. Gut zu erkennen ist die hochwertige Ausstattung, etwa ein breiter Abgang mit dem speziellen Holzboden, der superschnell trocknet, leicht zu reinigen ist und sich in allen Freibereichen findet. Er war superteuer, ist aber eine qualitative Aufwertung. Die Niro-Box gibt es zwei Mal, sie wird mit Süßwasser gefüllt und dort kommen nach dem Tauchgang die empfindlichen Teile wie Brillen, Computer sowie die Fotoausrüstungen und Lampen hinein. Die beiden Flossen gehören meinem Bruder und mir.
Die Gäste an Bord haben sich meiner Wahrnehmung nach an all die Vorgaben gehalten, sowohl was den Wasserflaschenverbrauch als auch das Duschen anbelangt.
Dafür ist der Verbrauch der Softdrink-Dosen enorm, was die Umweltbilanz wieder ordentlich zusammenhaut. Die Softdrinks sind im Preis inkludiert, lediglich Bier und Wein muss man zahlen, eine 0,5er-Dose kostet 3,50 Euro, eine Flasche südafrikanischer Wein 25 Euro.
Bier wurde nur wenig getrunken, wie die Stricherlliste am Ende der Woche gezeigt hat, Cola-Dosen und ähnliches jedoch in großen Mengen.
Da es in Ägypten keine Mülltrennung und somit auch keine Wiederverwertung gibt, landet der gesamte Müll auf Deponien (im besten Fall), hinter einer Düne (nicht so gut) oder im Meer (katastrophal)
Der Müll am Schiff wird jedenfalls nicht über Bord gekippt, bis auf die Speisereste, die werden auf hoher See entsorgt oder mit dem Zodiac ein paar hundert Meter vom Riff entfernt ins Meer geworfen, um nicht Haie anzulocken (auch wenn die Taucher sie gerne sehen).
Die Fäkalien werden aber ins Meer gelassen, und zwar geschieht das automatisch, wenn ein Tank voll ist. Hin und wieder taucht man dann durch so eine Wolke und ob die vom eigenen oder von einem anderen Schiff ist, bleibt sich gleich.
Das Service an Bord ist hervorragend, die Matrosen sind allesamt junge Männer, gut ausgebildet oder zumindest gut angelernt. Sie sind auf Dienstleistung programmiert und helfen schnell, wenn es notwendig ist – ob das jetzt ein wenig WD40 für meinen Brillenbügel ist oder ein frisches Handtuch.

Bild: Zwei der netten jungen Ägypter, die uns den Aufenthalt sehr angenehm gestalteten
Das Essen ist ebenfalls hervorragend, abwechslungsreich, immer mit Fisch, Huhn, viel Gemüse und Salaten. Wer will, kann sich an Bord ausgesprochen gesund ernähren. Im Laufe der letzten 25 Jahre hat sich das irgendwie durchgesetzt, dass es auf den Safaribooten gutes Essen gibt, ich kann mich an keines erinnern, wo das nicht der Fall war. Diesmal war alles noch eine Stufe höher, weil vielfältiger und wirklich gut gekocht.

Bild: Calamari, vegetarische Maki, dahinter überbackene Erdäpfel – es gibt drei Mal am Tag Buffet.

Bild: Salate, Rindsragout, Reis, Nudeln etc.
Wenn ich die Golden Dolphin IV mit den Schiffen vergleiche, auf denen ich Anfang der 2000er-Jahre war, so ist das heute purer Luxus. Die alten Schiffe waren halb so groß, hatten aber auch 16 Gäste an Bord. Es gab keine Zimmer mit Bad und WC, sondern enge Kajüten mit Stockbetten und einem indischen Klo (am Ende des Ganges). Da wir damals aber nichts anderes kannten, störte uns das nicht und die Tauchgänge waren – dazu komme ich noch – wesentlich schöner, wenn auch oft schwieriger.
Am meisten spüre ich den Unterschied bei langen Überfahrten. Da konnte es bei den früheren Safaribooten schon passieren, dass du in der Nacht bei jeder Welle in der Luft schwebst. Unser Schiff hingegen ist so groß, schwer und außerdem aus Stahl, dass der (bei dieser Safari eh nie hohe) Wellengang fast nicht zu spüren war.
Es gibt nur eine einzige Sache, die sich die ganz neuen mit den ganz alten Booten teilen: Du darfst kein WC-Papier ins WC werfen, das ist streng verboten. Seit immer schon haben sie ganz schmale Rohre, die durch das Papier sehr schnell verstopfen, was immer eine riesige Schweinerei verursacht. Das Papier kommt in eine kleine Plastiktonne, die einmal am Tag geleert wird.
Auf dieser Tour haben sich alle daran gehalten.
Die Taucher:innen
Wenn man keinen Vollcharter hat, weiß man natürlich nicht, wer aller an Bord sein wird. Das ist meistens eine gemischte Partie mit Taucherinnen und Tauchern aus der ganzen Welt. Diesmal waren es 4 aus Österreich, 9 aus Deutschland und 13 aus der (West)Schweiz.
Somit wurde an Bord Deutsch, Französisch, Englisch und Arabisch gesprochen. Weil die „Welschen“, also die französischsprachigen Schweizer, miteinander französisch sprachen und die anderen Deutsch, gab es eine gewisse Trennung, etwa beim Essen, beim Tauchen, aber auch am Abend an Deck. Ich war einer von denen, die da eine Brücke schlagen konnten, denn erstens kann ich (noch) ein wenig Französisch und zweitens sprachen einige Schweizer auch Deutsch. Verständigen konnten sich alle sowieso, wenn es notwendig war.
Der wohl schrägste und witzigste Typ an Bord ist Jose, ein alter Hase des Tauchens in Ägypten, der selbst schon Safariboote besessen hat und auch Anteile an der Golden Dolphin hat. Er ist auch zugleich der Guide für die Schweizer, bis auf Tatjana aus Zürich, die bei unserer Gruppe dabei ist, weil Deutsch sprechend.
Das taucherische Niveau ist recht hoch, es gibt etliche Tauchlehrer an Bord, bis hin zu Carsten, der Tech-Instruktor ist und Höhlentaucher und sonst noch einiges. Das war für alle ein Vorteil, weil das gesamte Tauchen durch die große Routine zu einer entspannten Sache wurde. Es gab wenig technische Defekte und fast keine Hoppalas wie vergessene Flossen oder versenkte Taucherbrillen.
Auch unter Wasser merkte man die Erfahrung aller Taucher:innen, beim Einstieg aus dem Zodiac oder wenn es darum ging einander nicht im Weg herumzutauchen.
Das Tauchen
Fast alle Taucher:innen hatten ihre eigene Ausrüstung mit. Meine ist eine der ältesten, die Tarierweste ist 30 Jahre alt und funktioniert immer noch hervorragend. Damals war die Qualität noch wesentlich besser als heute, leider.

Bild: Die alte, aber gute Tarierweste ist schon auf der Flasche befestigt und bleibt dort auch für den Rest der Woche. Jeder Taucher hat seinen fixen Platz mit einer Kiste darunter, in der die übrigen Teile der Ausrüstung auf den nächsten Tauchgang warten. Die Flaschen werden am Platz befüllt.
Wichtig sind stets die Tauchguides. Das sind in Ägypten meistens Ägypter und normalerweise haben sie sehr viel Erfahrung, kennen alle Riffe und sind Profis für das Safaribusiness. Wir haben diesmal Hazem und Omar, wobei zweiterer auch sehr gut Deutsch spricht.
Tauchguide ist kein einfacher Job, denn die Touristen verlangen stets Höchstleistungen. Als Guide musst du immer gut gelaunt sein und dich quasi auf jeden Tauchgang freuen. Du darfst nie krank sein und musst allen zu jeder Zeit für jedes Anliegen zur Verfügung stehen.
Wenn man bedenkt, dass die Saison fast rund ums Jahr geht und die Guides eine Gruppe am Donnerstag Vormittag verabschieden und die nächste am Donnerstag Nachmittag willkommen heißen, lässt sich erahnen, dass das herausfordernd sein kann.
Unsere Guides waren im Laufe der Woche nicht ganz gesund und das ist das schlimmste, was dir passieren kann. Eine verstopfte Nase – vergiss den Tauchgang. Und selbst wenn du ins Wasser gehst, bist du nachher kaputt. Außerdem musst du nicht nur einfach ins Wasser, sondern den Tauchgang führen, d.h. stets auf alle achten, bereit sein einzugreifen wenn irgendwas passiert und außerdem noch mit einem 360-Grad-Blick alles sehen, was es zu sehen gibt und die Taucher:innen darauf aufmerksam machen.
Und wenn ein Tauchgang einmal nicht perfekt ist, weil die Strömung doch anders ist als erwartet, gibt es sofort Kritik und Zweifel an deiner Kompetenz.

Bild: Links der Kapitän im Gespräch mit Hazem, einem unserer beiden Tauchguides
Wir waren für die Guides wenigstens keine schwere Aufgabe, weil die Taucher:innen sich alle sehr gut um sich selbst kümmern konnten und auch schwierigere Tauchgänge kein Problem waren, etwa mit stärkerer Strömung, die es in dieser Woche aber eh fast nicht gab.
Für jeden Tag gibt es einen Tauchplan, der am Oberdeck hängt. Bei den meisten Tauchtouren gibt es vier Tauchgänge pro Tag, wir hatten diesmal leider nur einen Nachttauchgang, weil in den Marineparks das Nachttauchen verboten ist.

Bild: Die Tafel mit dem täglich neuen Tauchplan.
Ergänzt wird der Plan durch das Briefing vor jedem Tauchgang. Hazem ist noch von der alten Schule und zeichnet die Tauchplätze auf Whiteboards. Inzwischen haben alle Schiffe große Flachbildschirme, auf denen die fertigen Bilder aufgerufen werden. Dann wird der Tauchgang ausführlich besprochen: Was es alles zu sehen gibt, wie tief wir gehen, wo wahrscheinlich Strömung zu erwarten ist und noch vieles mehr.

Bild: Das Daedalus-Riff. Anhand dieser Zeichnung werden die Tauchgänge geplant – etwa ob man die Ost- oder die Westseite betaucht, wo das Schiff festgemacht hat usw.
Am Donnerstag Vormittag legte das Schiff ab und kurz danach gab es den ersten Tauchgang auf Abu Dabab Nr.6 – rechtzeitig bevor die Tagesschiffe da waren. Danach ging es in den Süden zu Elphinstone, leider ist das Betauchen von „The Arch“ inzwischen verboten.

Bild: Das ist ein typisches Riff, lanzenförmig mit je einem Plateau an beiden Spitzen. Die Szene zeigt wie wir gerade ankommen und einer der Matrosen mit dem dicken Seil zum Riff fährt, um es dort an einer der Fixleinen (Mouring Lines) zu befestigen. So müssen die Schiffe nicht am Riff ankern, was natürlich sowieso verboten ist.
Nach dem zweiten Tauchgang geht es zurück zu Abu Dabab, weil wir dort den (leider einzigen) Nachttauchgang machen können. Glücklicherweise erwies sich der als Volltreffer. Highlight waren für mich die beiden Calamari, die am Bild nicht in ihrer ganzen Pracht herauskommen.

Bild: (von Jennifer Gary) Gute Bilder bei einem Nachttauchgang zu machen ist gar nicht leicht. Jenny hat dafür die (erstaunlich tolle) GoPro genommen. Die Calamari schillerten violett-bunt und vor allem die riesigen Augen machen sie zu Geisterwesen unter Wasser.
Als Jenny und Thomas gerade umgedreht haben, entdeckt Peter zwei spanische Tänzerinnen, die sind sowieso das Highlight eines jeden Nachttauchgangs. Leider hatten wir beide keine Kamera dabei.
Ich tauche supergerne in der Nacht, die Eindrücke sind so ganz anders und die Nachttauchgänge bleiben mir in Erinnerung, auch wenn sie schon dreißig Jahre her sind. Es ist generell so, dass ich mich an viele Tauchgänge von früher erinnere, vor allem weil der Unterschied der Unterwasserwelt so eklatant ist.
In der Nacht legen wir ab und fahren fast sieben Stunden in den Südosten zum Daedalus-Riff. Das habe ich durch seine Hammerhai-Schule in bester Erinnerung und wir hoffen diesmal auch welche zu sehen.
Die Fahrt ist ruhig, es gibt wenig Wellen und wir kommen noch lange vor Sonnenaufgang an unserem Liegeplatz an.

Bild: Daedalus in der Morgensonne
Meine Nase ist immer noch ziemlich zu, das Tauchen sollte aber möglich sein. In der Kabine ist es trotz offenem Fenster heiß und stickig, die Temperatur ist für Oktober eigentlich zu hoch, wenngleich der Oktober der beste Monat ist, sozusagen zwischen Sommerhitze und Winterkühle.
Daedalus ist ein großes Riff mit einem Leuchtturm. Die Tauchgänge verlaufen leider erfolglos, die Haie lassen sich nicht blicken. Für sie ist das Wasser einfach zu warm, wir messen auf 30 Meter Tiefe 29 Grad, das ist um 3 Grad zu warm für die Hammerhaie, die somit weiter unten bleiben und für uns außer Reichweite.
Das einzige, was wir zu sehen bekommen, war ein Longimanus, also ein Weißspitzen-Hochseehai. Das sind tolle Tiere, die recht neugierig sind und nahe an Taucher heranschwimmen.

Bild: (Jennifer Gary) Ein Longimanus, gut an seinen geschwungenen Seitenflossen zu erkennen. Das Exemplar ist ca. 2 Meter lang.
Erschreckend ist der Zustand des Riffs. Geschätzte 2/3 der Hartkorallen sind von der Korallenbleiche betroffen. Wenn das Meer einige Zeit 32 Grad oder wärmer ist, stoßen die Korallen ihre Partneralgen ab und die Polypen sterben. Zurück bleiben blütenweiße Kalkskelette, die nach einiger Zeit von irgendwelchen Algen überwuchert werden. Das ist dann der letzte Zustand eines toten Riffs.

Bild: (Hannes Keppeler) Eine tote Koralle. Rundherum sind weitere gebleichte Korallen sichtbar, daneben bereits überwucherte. Mehr dazu später.
Das Riffdach war schon vor zwanzig Jahren nicht mehr sehr schön, jetzt ist es tot. Den Leuchtturm kann man immer noch besichtigen, eine willkommene Abwechslung, die gerne und meistens von allen in Anspruch genommen wird. Nach den drei heutigen Tauchgängen auf Daedalus haben wir Zeit, weil es ja keinen Nachttauchgang gibt.

Bild: Auf einem Pier wandert man zum betonierten Sockel des Leuchtturms. Links daneben sieht man die Reste des alten Jettys, der schon seit Jahrzehnten vor sich hinrostet. Da macht sich auch niemand die Mühe ihn wegzuräumen.

Bild: Meine Wenigkeit am Weg zum Leuchtturm
Der Blick von oben entschädigt für den mühsamen Aufstieg über die steile Wendeltreppe. Interessanterweise wurde irgendwann die alte Fresnel-Linse (1822 entwickelt) gegen ein modernes LED-System ausgetauscht. Das ist nicht mehr so effizient, was aber egal ist, weil die Leuchttürme in GPS-Zeiten ohnehin nicht mehr gebraucht werden. Sie sind halt noch in Betrieb, inzwischen energiesparend. Aus nostalgischen Gründen vermisse ich die Fresnel-Linsen mit ihrer enormen Leuchtkraft. Wenn wir früher am Abend von einem Leuchtturm weggefahren sind, konnte man sein Licht noch stundenlang sehen, bis es irgendwann hinterm Horizont verschwunden war.

Bild: Die moderne Linse
Die Abendstimmung ist toll, einige von uns kaufen ein T-Shirt (davon leben die Leuchtturmwärter) und dann genießen wir noch den Abend.

Bild: Der Blick Richtung Westen. Weil es ungewöhnlich klar ist, sieht man sogar die Berge an der Küste. Das hatte ich noch nie.
Nach dem etwas enttäuschenden Besuch von Daedalus geht es in den Norden zu den Brothers. Das sind zwei Inseln mitten im Roten Meer, zwei ehemalige Vulkane auf einem gemeinsamen Stock, der ca. 2,5 Kilometer lang ist. Die Inseln sind (wie die Riffe) lanzenförmig mit Riffdächern und Plateaus auf jeder Seite. Big Brother ist nördlicher, Little Brother zwei Kilometer weiter südlich.
Das erklärt auch, warum es mitten im Roten Meer Riffe gibt. Es ist dort immerhin ca. 800 Meter tief.

Bild: Gut erkennbar ist der Basaltstock, das sind uralte, erkaltete Lavaströme, also die Reste des Vulkans bei Big Brother

Bild: Big Brother, das Bild stammt von der Rückfahrt, als wir gerade abgelegt haben und Richtung Norden nach Hurghada unterwegs sind. Drei Safariboote liegen noch dort.
Die Fahrt dauert die ganze Nacht, wir legen aber rechtzeitig für den Early-Morning-Dive an, und zwar beim Little Brother, weil dort weniger Schiffe sind. Das ist nämlich so eine Sache mit den Safarischiffen, sie fassen alle ca. 20 Taucher:innen und alle haben natürlich ein Interesse an möglichst schönen Tauchgängen. Die sind von den Tauchplätzen her begrenzt, in der Früh etwa wollen alle die Sonnenseite. Wenn man Pech hat, werfen zur gleichen Zeit fünf Tauchschiffe mittels zehn Zodiacs insgesamt etwa hundert Taucher ins Wasser. Dann wurlt es unter Wasser, vor lauter Luftblasen sieht man wenig bis nichts und das Tauchen ist nicht wirklich ein Genuss.
Daher sprechen sich die Kapitäne der Schiffe untereinander ab, so dass nicht alle zur gleichen Zeit gehen. In der Früh ist das schwierig, weil alle eben vor dem Frühstück tauchen gehen wollen. Wie der Tauchgang verläuft, hängt aber von vielen Faktoren ab, einer ist die Strömung. Gegen die kann man nicht ankämpfen, wenn sie einen erwischt – also im Idealfall immer die ganze Gruppe, das ist wichtig – dann treibt man am Riff entlang. Das ist nicht ohne Charme, weil man tariert sich auf eine Tiefe aus und treibt gemächlich am Riff vorbei. Das geht unterschiedlich flott, im Idealfall kommt man bis zum Schiff zurück und erspart sich das Setzen der Boje und das Reinklettern ins Zodiac.

Bild: Little Brother ist wirklich little, im Hintergrund ist Big Brother zu sehen, mit einer ganzen Menge Safarischiffe. Die Tagesboote dürfen dort gar nicht hinfahren, die Vorschrift verlangt zwei Motore, was sie nicht haben. Für unerfahrene Taucher sind die Brothers aber sowieso nix.
Bei den Brothers versuchen die meisten Gruppen auf Haie zu gehen. Das bedeutet, man steigt oben an der nördlichen Spitze ein (mit leerem Jacket vom Zodiac hintenrum reinplumpsen lassen und sofort abtauchen auf ca. 5 Meter, dort sammeln und dann schauen, wo es hingeht) und versucht in Sichtweite des Riffs im Blauwasser zu warten, ob was vorbeischwimmt. Ich mache es kurz: Wir haben fast nichts gesehen.

Bild: (Hannes Keppeler) Das ist Carsten im Blauwasser, der darauf wartet, dass irgendwas auftaucht.
Was wir glücklicherweise schon sehen konnten, war ein Fuchshai. Die sind eher selten und mit ihrer langen Schwanzflosse sehr leicht zu identifizieren. Ich hatte vor 15 Jahren genau am Little Brother schon einmal einen gesehen, diesmal war er aber viel näher.

Bild: (Jennifer Gary) Der Fuchshai, bei mir schwamm er nur ein paar Meter weit entfernt vorbei.
Die Korallen bei den Brothers sind in ähnlich schlechtem Zustand wie bei Elphinstone und Daedalus, wenngleich es weniger Korallenbleiche gibt. Je weiter südlich, desto schlimmer, weil desto wärmer ist das Meer, vor allem im Sommer. Ich mag mir gar nicht ausmalen, wie es im Sudan oder noch weiter südlich aussieht.
Am Brutalsten finde ich die unfassbare Geschwindigkeit der Entwicklung. Die Korallenbleiche kam in diesem riesigen Ausmaß erst vor zwei Jahren. Auch wenn Jose meint, vor ein paar Wochen war noch alles super, ich kann ihm das leider nicht glauben. Auch die Annahme, dass sich das bald regenerieren wird, ist wohl mehr Wunschdenken und abseits aller Realität.
Damit kommen wir zu einem wichtigen Thema.
Das Sterben der Riffe
„Meine Güte, dann gibt es halt keine Korallenriffe mehr – wen stört das schon?“ Diesen Satz werden wir in den nächsten Jahren noch oft hören. „Deswegen werden wir auf die Steigerung unseres Wohlstands nicht verzichten“ werden zwar weniger Menschen sagen, aber genau darum geht es.
Der Reihe nach.
Schon Hans Hass hat in den 1960er-Jahren mit dem Tauchen aufgehört, weil er die Entwicklung nicht mehr ausgehalten hat. Dabei war das damals erst der Beginn der Auswirkungen der Umweltzerstörung, die Riffe waren noch in einem Zustand, der uns heute paradiesisch erscheinen würde. Hans Hass ist (kleines Outing) eines meiner Vorbilder. Seit Pioniergeist, sein Mut, seine Entschlossenheit sind bewundernswert, ich habe leider die Chance, ihn persönlich kennenzulernen, versäumt. Gleichzeitig mit Jacques-Yves Cousteau hat er das moderne Tauchen erfunden und vieles, was heute die Basis darstellt. Ähnlich wie Reinhold Messner punkto Bergsteigen hat er aber auch die Entstehung des heutigen Tauchtourismus ausgelöst. Seine Bilder der bunten Unterwasserwelt waren in den 1950er- und 60er-Jahren nicht nur neu, sondern auch höchst attraktiv.
„Die Touristen zerstören das, was sie suchen, indem sie es finden“ ist der wohl passendste Spruch für das, was weltweit derzeit passiert, auch beim Tauchen.
Ich darf mich da selbst nicht ausnehmen. Die Flugreise, das Schiff, das Hotel und noch einiges mehr – die Umweltbilanz so einer Tauchreise ist katastrophal.
Die Konsequenz zu ziehen und mit dem Tauchen aufzuhören, fällt auch mir schwer und ich verlange sie von niemand anderem. Aber ich erlaube mir darzustellen, was ich sehe und welche Schlüsse ich daraus ziehe.
Es muss ja niemand lesen.
Die ursprüngliche Pracht der Korallenriffe ist heute nirgends auf der Welt mehr zu finden, genau genommen schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Der Tauchtourismus kam in den 1970er-Jahren richtig in Fahrt, indem er professionalisiert wurde. Es entstanden die großen Tauchsportvereinigungen wie PADI, CMAS und SSI. Die Ausrüstungsfirmen (allen voran Scubapro) erlebten ihre größte Wachstumsphase und alles zusammen entwickelte sich zu einem Teil der Tourismusindustrie. Hurghada war in den 1970er Jahren ein Fischerdorf, heute hat es knapp 200.000 Einwohner und ist der größte Tourismusort am Roten Meer. Sehen wir uns an, was Wikipedia dazu sagt:
„Beim Kampf um die besten Plätze setzten Investoren Bootsstege und ganze Hotelkomplexe auf die Riffe. Dabei wurden an Hurghadas Küste über 2 km² Landfläche durch Sandaufschüttungen gewonnen. Dabei erstickte nicht nur die zugeschüttete Meeresfauna und Flora; durch verstärkte Sedimentation und veränderte Strömungsmuster ging auch ein Großteil der angrenzenden Korallenriffe zu Grunde.
Durch die Anker der Tauchtouristenboote, die hohe Anzahl durchgeführter Tauchgänge mit häufig schlecht ausgebildeten Sporttauchern, das Aufwirbeln von Sand, das Abbrechen der Korallen als Souvenirs und das mangelnde Umweltbewusstsein der einheimischen Bevölkerung haben die Riffe vor Hurghada schweren Schaden genommen. Sie sind auf lange Zeit schwer beschädigt oder gar zerstört. Die wissenschaftlich errechnete Verträglichkeitsgrenze von ca. 6000 Tauchgängen pro Jahr und Tauchplatz, bei deren Überschreitung Schäden an den Riffen und der Unterwasserwelt exponentiell zunehmen, wurde bei Hurghada bereits Anfang des 21. Jahrhunderts zum Teil schon innerhalb eines Monats erreicht. Außerdem werden viele Abfälle von den Booten oder Bootsstegen aus direkt in das Meer geworfen. Der Meeresgrund unter den Stegen und Anlegeplätzen ist häufig von Müll bedeckt, von dem Gefahren für Tiere und Menschen ausgehen.“ (Quelle: Wikipedia)
Hurghada streckt sich über 30 Kilometer an der Küste hin und wächst immer noch. Als ich 2004 eine Woche segeln im Roten Meer war (das geht sich umweltmäßig zumindest einigermaßen gut aus), starteten wir in El Gouna, 20 km nördlich von Hurghada. Mit dem Taxi fuhr ich am Weg an einem riesigen Windpark vorbei, der aber nicht in Betrieb war. Als ich nachfragte, wurde mir erklärt, dass dieser Windpark Ägypten im Zuge der Entwicklungshilfe von den G7-Staaten geschenkt worden war. Er wurde aber nie in Betrieb genommen, weil die ägyptische Regierung zeigen wollte, dass sie so einen Windpark nicht braucht und all ihre Energie durch Öl decken kann.
Wer eine Nordtour macht, kann vom Safarischiff aus unzählige ehemalige Bohrinseln sehen, die dem Verfall preisgegeben werden. Wenn ein Ölfeld ausgebeutet ist, erschließt man einfach das nächste. Der Benzinpreis ist staatlich geregelt, ein Liter kostet ca. 20 Cent, bei uns zahlt man das Achtfache.
Würde der Sprit so viel wie bei uns kosten, wäre eine Tauchsafari doppelt so teuer. Wir sind also alle Teil des Systems der Ausbeutung der Natur, wenn wir eine Reise dorthin machen, ob wir wollen oder nicht.
Es geht ja nicht nur um den Treibstoff, das gesamte Wasser wird durch das Verbrennen von Öl gewonnen, das im Überfluss verwendete Plastik detto.
Das alles bewirkt nicht nur die Klimakrise, sondern wirkt sich auf mehreren Ebenen auf die tropischen Meere aus. Die drei Hauptfaktoren für die Riffe sind folgende:
1.) Die Erwärmung der Meere. Die Wassertemperatur vor Hurghada wird auf Wikipedia für die Monate Juli und August mit 30 Grad angegeben, im Februar mit 22.
Heuer betrug sie im Sommer 32 Grad, das ist einfach zu viel für die Korallen, sie sterben ab. Marsa Alam liegt ca. 300 Kilometer weiter im Süden und wir hatten im Oktober 30 Grad und – wie schon erwähnt – 29 Grad in 30 Metern Tiefe. Das ist ein Killer.
2.) Die Betauchung
Wahrscheinlich ist das der geringste Faktor, aber er spielt eine sichtbare Rolle. Begonnen hat das erst durch die Industrialisierung des Tauchsports. Inzwischen entsteht der Schaden nicht mehr nur direkt durch das, was die Taucherinnen und Taucher unter Wasser bewirken, sondern auch durch die Infrastruktur, die dafür geschaffen wurde. Die Safariboote sind ein gutes Beispiel, die Fliegerei ein weiteres und alles, was rundherum noch notwendig ist, ergänzt das Gesamtpaket.
Unter Wasser kommt es sehr darauf an, wer taucht und wie getaucht wird. Die erste Belastung entsteht durch ungeübte Taucher, die z.B. gerade erst ihren Tauchschein gemacht haben. Sie können noch nicht gut tarieren und stoßen daher unkontrolliert an die Korallen. Ein Ast braucht hundert Jahre um zu wachsen und ist in einem Augenblick abgebrochen.
Ein bisschen was halten die Korallen schon aus und von diesen Schäden können sie sich auch wieder erholen.
Die eigentliche Belastung entsteht – wie so oft – durch die Gesamtmenge vieler hunderttausender Taucher, die alle Korallenriffe dieser Welt bereisen.
Dazu möchte ich anmerken, dass es auch die Taucherinnen und Taucher sind, denen die Unterwasserwelt ein Anliegen ist und die sich für ihren Schutz einsetzen. Trotzdem bleibt aus meiner Sicht eine bedenkliche Entwicklung, nämlich die Unterwasserfotografie. Jenny hatte eine kleine GoPro-Kamera an einem Stiel, mit der sie Filme machen konnte. Die Kamera ist leicht, klein und sie kann sie in einer Hand halten. Daraus entstehen keine Probleme. Dann gibt es aber auch die Taucher, die mehr oder wenige riesige Apparate mit sich herumschleppen. Sie müssen, um ein gutes Foto zu machen, sich irgendwo abstützen. Ich konnte bisher nur ganz wenige Fotografen beobachten, die frei schwebend fotografiert haben. Fast alle knien sich auf die Korallen oder halten sich mit einer Hand daran fest. Das richtet leider erheblichen Schaden an, die Priorität der Taucher liegt leider immer am Foto.
Ich freue mich natürlich auch über gute Bilder, das sind tolle Erinnerungen, aber derzeit sieht es für mich nach einer Entwicklung aus, die ich für zu extrem halte.
3.) Die Verschmutzung der Meere. Das Rote Meer ist so etwas wie die Südost-Tangente der Meere, unfassbar viel befahren. Obwohl man es heute per Satellit schon sehen kann, werfen alle Schiffe ihren Dreck ins Meer. Das allein ist es zwar noch nicht, aber die Summe allen Drecks über viele Jahre und Jahrzehnte setzen dem Meer zu. Die Riffe liegen an der Küste, dort ist die Belastung aber noch viel höher. Die Ressorts und Hotels an der Küste sind auf Gewinnoptimierung konzipiert, für Abfallentsorgung ist da meist kein Budget vorgesehen. Sie bauen daher Rohre ins Meer, die in hundert Metern Entfernung von der Küste die Abwässer hineinleiten. (Ich habe diese Rohre selbst gesehen.) Diese Ressorts sind für ca. fünf, maximal zehn Jahre Betriebsdauer gebaut. Dann sind sie abgewirtschaftet, die Elektrik am Ende, die Rohrleitungen kaputt etc.
Dann müssen sie ihren Gewinn eingespielt haben, koste es was es wolle. Danach werden sie einfach stehengelassen und man baut daneben das nächste, neue Ressort.

Bild: Südlich von Port Ghalib am Weg zu Elphinstone. Man sieht links ein Ressort in Bau, rechts daneben eines, das gerade in Betrieb ist.
Die Ressorts und Hotels sind geschlossene Anlagen, die von den Touristen meist nur für Jeepsafaris und ähnliches verlassen werden. Sie besitzen alle Pools und sind zur Gänze klimatisiert. Sie sind aus Stahlbeton gebaut und haben einen enormen Ressourcenverbrauch in so ziemlich jeder Hinsicht, auch weil der Anspruch der Touristen ständig steigt: Statt einer normalen Dusche muss es eine Regenwalddusche sein, das neue Hotel hat eine noch größere Pool-Anlage und ein um zehn Meter längeres Buffet in jedem seiner vier Restaurants als das Hotel daneben.
Das bedeutet auch, dass täglich Unmengen an Nahrungsmitteln weggeworfen werden, ich wage sogar zu behaupten, dass die Tourismusindustrie die Spitze der Wegwerfgesellschaft darstellt (und erinnere an das Beispiel mit dem Plastikbutterschüsserl).
Der Hintergrund ist die Urlaubsgesellschaft, die auf dem Modell der Work-Life-Balance aufbaut. Dieser Begriff bedeutet, dass Arbeit kein Leben ist, sonst müsste man der Arbeit ja nicht das Leben gegenüberstellen, als Gegensatz sozusagen.
Der Urlaub ist also die Zeit, in der ich nicht arbeiten muss und somit lebe. Zum Leben gehört das Genießen, die Freizeit, die Entspannung – all das, was ich im Bergwerk nicht habe.
Daher ist der Urlaub da um zu genießen, um das zu haben und zu holen, was man daheim nicht hat. Dazu gehört auch Luxus, also der Genuss des Nicht-Alltäglichen. Wer täglich zehn Champagnerflaschen trinkt, weil er sie einfach zur Verfügung hat (warum auch immer), wird den Champagner nicht mehr als Luxus empfinden. Luxus ist das Gegenteil von Verknappung, Luxus ist somit der Genuss der Verschwendung.
Wer sich mit offenen Augen in einem Hotel an ein Buffet stellt, kann das beobachten: Viele Menschen nehmen sich wesentlich mehr, als sie essen können. Es ist ja im Überfluss da, ein kleines Abbild des Modells vom Schlaraffenland.
Wer genießen will, möchte sich diesen Genuss möglichst nicht trüben lassen, etwa von Gedanken an Umweltschutz. Die schiebt man im Urlaub gerne weg (ich versuche das auch, schaffe es nur immer seltener), das gehört nicht zum schönen Teil des Lebens.
Deswegen versuchen wir es uns im Urlaub so angenehm wie möglich zu machen – vielleicht mit Ausnahme der Abenteuerurlauber, aber das ist ein anderes Thema, in Hurghada gibt es die nicht.
Am Tauchschiff schon eher, der Early-Morning-Dive ist manchmal eine ungemütlichen Angelegenheit, vor allem, wenn es kühl ist und man in den nassen Tauchanzug hinein muss.
Egal – auch an Bord versuchen wir so viel Luxus wie möglich zu bekommen und die Golden Dolphin IV ist dafür optimiert. In der Wüste ist Wasser Luxus und Klimaanlagen sind es auch, genauso wie überquellende Buffets mit all dem, was in der Wüste nicht wächst. (Einer der Gründe, warum ich nicht mehr auf die Malediven reisen werde – dort wird bis auf Kokosnüsse alles von weither importiert.)
Luxus bedeutet, dass es mir gut geht, wir greifen hier auf ein archaisches Muster der menschlichen Evolutionsgeschichte zurück, das tief in uns sitzt. Über Jahrhunderttausende war der Mensch ein Mangelwesen, ist in Krisen verhungert und hat immer Zeiten überstehen müssen, die von Mangel geprägt waren.
Erst seit wenigen Jahrhunderten, tw. seit wenigen Jahrzehnten ist das anders. Wir sind es gewohnt immer alles zu haben, was wir brauchen, im Idealfall im Überfluss.
Je mehr wir haben, desto mehr gewöhnen wir uns auch daran und empfinden irgendwann jede Art der Einschränkung als Zumutung, als unzumutbar.
Daraus leiten wir irgendwann ein Recht auf Überfluss und Luxus ab, das uns nicht genommen werden darf. Die Perversion (also die Entwicklung ins Krankhafte) dessen haben wir in der Corona-Krise erlebt, wo Menschen es als unzumutbare Freiheitseinschränkung empfunden haben, wenn sie ein paar Wochen bestimmte Formen von Luxus (Fitnesscenter, Skiurlaub, Restaurant etc.) nur eingeschränkt oder gar nicht genießen konnten.
Kehren wir mit diesem Beispiel zurück an Bord der Golden Dolphin. „Na geh, schon wieder Fisch“ war die Aussage, als uns das serviert wurde:

Bild: (Hannes Keppeler) Mittagsbuffet an Bord
Okay, die Aussage kam mit einem Augenzwinkern, aber wir alle sind in dieser Dynamik der Überflussgesellschaft gefangen. Der Ausbruch aus diesem Gefängnis ist schwierig und oft stellt sich die Frage, ob es herinnen nicht besser ist als draußen. Selbstverständlich bin ich selbst dagegen auch nicht gefeit, als wir in unserem Hotel einen Cocktail bekamen, motzte ich ordentlich, dass der nicht gut gemixt wäre, mit Orangensaft, der diese Bezeichnung nicht verdient etc.
Wenn es in der Evolution reiche Jagdbeute gab, hat man sich meistens darum gestritten und dann so viel verschlungen wie man konnte – es war ja nicht klar, ob es am nächsten Tag wieder was geben würde. Heute ist der Überfluss die Normalität und jede Abweichung wird als störend empfunden, als unzumutbare Normverletzung.
Die Grenzerfahrung von Corona hat interessanterweise nicht zu einer Besinnung geführt, sondern im Sinne der Konsumgesellschaft zu einem „jetzt erst recht mehr genießen, wer weiß, wie lange es noch geht“. Auf dieser Basis lässt sich natürlich keinerlei Umweltschutz entwickeln, das ist klar. Luxusmaximierung und Umweltschutz sind einander diametral.
Es greift das alte, archaische Muster: Ich stopfe mir so schnell wie möglich den Bauch möglichst voll, vielleicht geht es morgen nicht mehr. „Jetzt noch einmal möglichst viel die Welt bereisen, sobald das Fliegen teurer wird, geht das eh nicht mehr.“ Das höre ich in meinem Umfeld immer öfter.
Die Rekordflugzahlen zeigen, dass da möglicherweise was dran ist. Erschreckend ist nur, dass wir dadurch zu einer Art pervertiertem Steinzeitindividuum werden – pervertiert deshalb, weil die Steinzeitmenschen sehr wohl an die Zukunft ihrer Kinder gedacht haben.
Das fällt jetzt völlig weg, wenn wir ihre Ressourcen heute schon selbst verbrauchen.
Zurück zur Golden Dolphin. Dort ist glücklicherweise allen klar, dass das Jammern auf hohem Niveau stattfindet, was das Schiff betrifft. Das Problem ist hier der Vergleich – wer an einem Riff schon einmal einen tollen Tauchgang gemacht hat, wird mit einem nicht so tollen unzufrieden sein. Das ist menschlich – es ist aber auch menschlich, das zu reflektieren und sein eigenes Denken (heute sagt man gerne „mindset“ dazu) entsprechend anzupassen, Ärger zu relativieren und sich auf das Schöne zu konzentrieren. Das hervorragende Essen wird z.B. von allen an Bord geschätzt, der üppige Platz überall ebenso. Ich selbst bin nur unzufrieden, wenn die Tauchflaschen nicht gut gefüllt sind. Das kommt ein paar Mal vor und ergibt sich aus der Differenz zu anderen, die gut gefüllte Flaschen haben. Der Ärger darüber ist aber nicht groß und mit einer kleinen Bitte lässt sich das binnen weniger Minuten erledigen.
Der Service an Bord ist wirklich gut, das gehört klar ausgesprochen.
Es fällt mir gar nicht leicht an die kaputten Riffe zurückzudenken, aber ich muss meine geschätzten Leser:innen noch ein wenig damit beschäftigen.
Sehen wir uns das folgende Bild einmal genauer an:

Bild: (Hannes Keppeler) Zwei Falterfische an einem Korallenstock
Vor einigen Jahren war dies ein bunter, kleiner Korallenstock mit einer Handvoll Hartkorallenarten, dazu eine Weichkoralle, ein oder zwei Seescheiden, vielleicht eine kleine Anemone und noch einige andere Pflanzen. In den Ritzen wohnten einige kleine Garnelen, es gab einen Seeigel, zwei Seesterne und noch viele andere kleine Tiere. Rundherum sind viele bunte Fische geschwommen.
Das folgende Bild (vor ca. 10 Jahren aufgenommen) zeigt auch nicht die ganze Pracht – vor allem die Farben fehlen, aber der Unterschied ist sichtbar

Bild: Hier ist noch eine Vielfalt sichtbar – lebend!

Bild: (Hannes Keppeler) Ein Masken-Kugelfisch an einem fast komplett toten Korallenstock beim Nachttauchgang

Bild: (Hannes Keppeler) Eine Muräne an einem Riff. Man sieht die vielen toten Stellen, unterhalb der Muräne eine kleine Koralle, leider auch schon bleich, also relativ frisch abgestorben. An diesem Bild kann man gut sehen, wie das Riff vergeblich versucht sich zu regenerieren.
Es sind aber nicht nur die kleinen Korallenstöcke, es ist vor allem das Gesamtbild, das mir Angst macht und in Bildern nicht gut darstellbar ist.
Die Korallenriffe nennt man nicht ohne Grund die Regenwälder der Meere. Die unglaubliche Vielfalt der Lebewesen, die gigantischen Strukturen, die im Laufe von Jahrmillionen aufgebaut wurden. Derzeit sieht es so aus, als ob es das in wenigen Jahren (nicht einmal Jahrzehnten) nicht mehr oder nur mehr in Resten geben wird.
Ich möchte die Problemlage aus meiner Sicht noch einmal zusammenfassen.
1.) Die Sommer werden immer heißer und es gibt keinen Hinweis darauf, dass sich diese Entwicklung irgendwann umkehren könnte. Selbst wenn es einmal ausnahmsweise einen kühlen Sommer gibt, ändert das nichts an der Problematik.
2.) Der Großteil der Korallen im Roten Meer ist jetzt schon tot bzw. stirbt gerade. Und das ist leider auch bei fast allen Riffen weltweit der Fall, das Great Barrier Reef in Australien als größtes Riff der Welt ist angeblich massiv geschädigt, die Malediven ohnehin, auch die Karibik, Indonesien und viele andere berühmte Gegenden mit tollen Riffen sind laut Berichten schwer unter Stress und bereits ziemlich kaputt.
3.) Das ist alles nicht neu, das geschieht seit Jahrzehnten, mehr oder weniger schleichend. Obwohl die Meeresbiologen und andere Wissenschafter Alarm schlagen, geschieht eigentlich gar nichts. Da und dort gibt es Initiativen um Riffe zu schützen, hitzefeste Korallen zu finden und zu züchten oder lokale Tauchverbote zu verhängen.
Das ist alles ehrenwert, in Summe aber wohl wirkungslos.
Das Problem liegt auch darin, dass die schleichende Entwicklung den Blick vernebelt. Es ist ja nur ein wenig schlimmer als vor drei Jahren. Und selbst wenn die Schäden eklatant sichtbar sind, wie derzeit die Korallenbleiche, war ich auf dem Schiff der Einzige, der das zur Sprache brachte. Alle anderen haben versucht die Reste zu genießen. (Falls ich jemandem Unrecht tue, bitte um Verzeihung. Da und dort habe ich in den Gesprächen schon heraushören können, dass man die Entwicklung bedauert.) Und wenn ein Tauchort wie das Rote Meer kaputt ist, fliegt man dann halt irgendwo anders hin, wo es noch etwas besser ist. Das verstärkt dann den Druck auf diese Gebiete.
4.) Die Verschmutzung nimmt weiter ungebremst zu. Es gibt zwar heute schon die Möglichkeit per Satellit zu erkennen, wenn Schiffe ihren Dreck ins Meer lassen, aber ich habe noch nie gehört, dass es zu spürbaren Strafen oder anderen Konsequenzen gekommen ist. Viele Schiffe fahren auch extra hinaus, um Giftmüll im Meer loszuwerden, die berühmte Dünnsäureverklappung ist hier ein Begriff. Gibt es Verbote, die auch exekutiert werden? Gibt es irgendeine Entwicklung weg vom Schweröl, mit dem die meisten Frachter und Kreuzfahrtschiffe betrieben werden? Wird irgendwo weniger Plastik ins Meer geschmissen? Ich höre immer nur von einer weiteren Steigerung, was ja auch logisch ist: Die Wirtschaft soll wachsen, dadurch werden mehr Dinge erzeugt und das ergibt mehr Müll, weltweit versteht sich.
5.) Der Post-Covid-Effekt ist weltweit sichtbar: schnell noch genießen, schnell noch ausnützen, ich möchte noch etwas erleben, ich möchte mir etwas gönnen, ich finde, die anderen sollen zurückstecken, ich sicher nicht.
In einer Welt, in der Egoisten für den Konsumwachstum gefragt sind (in jedem Haushalt braucht es eine Bohrmaschine, obwohl das ganze Haus nur eine bräuchte), In einer Welt, in der für viele Menschen das einzige, zumindest aber das größte Glücksversprechen die Konsumsteigerung ist, brauchen wir uns über die derzeitige Entwicklung nicht wundern und auch nicht auf einen Gegentrend hoffen.
6) In einer Welt, in der die Krisenmenge und -vielfalt ständig zunimmt oder es zumindest danach aussieht (die Medien füttern das fleißig nach dem Motto „only bad news are good news), steigt der Wunsch nach Sicherheit und Bequemlichkeit. Das ist direkt konträr zum Umweltschutz, der dann konsequenterweise ausgeblendet wird.
7.) Stark wachsende Bevölkerungen rund um den Globus haben wachsende Bedürfnisse, geleitet von der westlichen Konsumkultur.
8.) Wir haben Kaskadeneffekte. a.) Die derzeitige Entwicklung an den Korallenriffen betrifft nicht nur die Korallen. Wenn sie tot sind, sterben auch die Korallenfische und danach alle Lebewesen, die sich von all dem ernähren. Danach die Großfische usw. Zusätzlich fehlt dann der Korallensand an den Küsten, die dadurch stärker erodieren, mehr Sedimente ins Meer bringen, wodurch die restlichen Korallen ersticken etc.
b.) Wenn die Riffe tot sind, kommen weniger Touristen. Dann müssen die Preise steigen, was zu noch weniger Touristen führt. Wenn man die Preise jedoch senkt, geht das nur auf Kosten der Umwelt. (Abwässer ins Meer leiten ist billiger als eine Kläranlage etc.)
9.) Es gibt derzeit fast keine Bewusstseinsentwicklung, weil die Menschen a.) andere Sorgen haben, b.) nur wenig berichtet wird und c.) die Konsequenzen schwer vorstellbar sind, wenn man noch nie ein sterbendes Riff gesehen hat.
Das bedeutet aber auch, dass wir nur durch eine entsprechend sichtbare und spürbare Katastrophe lernen werden. Und die muss wahrlich gewaltig sein, wie wir an einigen Beispielen sehen können: Das Hochwasser in Niederösterreich Mitte September 2024 hat enorme Schäden angerichtet. Der Tenor lautet aber: Der Staat soll die Schäden bezahlen und dann machen wir so weiter wie bisher. Wird schon nix mehr passieren!
Es gibt keine, absolut keine Konsequenzen in Richtung Maßnahmen zur Vermeidung solcher Hochwässer. Man tut ein wenig gegen die Symptome, greift die Ursachen aber nicht an.
10.) Wir halten die kognitive Dissonanz sehr gut aus: Unter Wasser bestaunen wir die Fische, ober Wasser essen wir sie. Ich als Grüner zahle für die Erhaltung des Nationalparks und trage zugleich zu seiner Zerstörung bei etc.
Die Lösungsansätze
Genau genommen gibt es keine, denn in einer hedonistischen Welt ist etwas anderes als ewige Konsumsteigerung nicht denkbar.
Trotzdem möchte ich einige Ideen zur Diskussion stellen.
1.) Mengenbeschränkungen
Das gibt es schon da und dort, eventuell könnten bestimmte Entwicklungen dadurch etwas abgefedert oder hinausgezögert werden.
2.) Einen Tag säubern, zwei Tage tauchen
Das widerspricht zwar dem Urlaubsgedanken und auch der Bequemlichkeit, könnte aber zur Bewusstseinsbildung beitragen. Unter Wasser befindet sich jede Menge Müll, den man raufholen und ordentlich entsorgen könnte.

Bild: (Jennifer Gary) Hazem hat ein altes Seil von einer Mouring-Line runtergeschnitten und nimmt es zum Schiff mit. Dort wurde es eingelagert und mit dem Müll in Hurghada entsorgt.
3.) Kontrollierte, gewidmete Umweltabgaben
Nur wenn ich weiß, was damit gemacht wird, zahle ich gerne. Das gilt für Steuern und würde auch für Umweltabgaben gelten.
4.) Ehrliche, sichtbare Umweltbilanzen
Auch das widerspricht dem störungsfreien Urlaubsgedanken, weil es ein schlechtes Gewissen machen könnte. Trotzdem wäre es interessant, welche Umweltbilanz tatsächlich durch so einen Tauchurlaub entsteht.
5.) Ein Totem-Rifftier
Oder auch eine Pflanze – egal. Damit ist gemeint, dass sich jeder Taucher ein Lebewesen aussucht, das ab da „seines“ ist. Für das übernimmt er (sie) eine gewisse Verantwortung. Das könnte sein…
…Infos über dieses Tier sammeln, wie ist der Bestand, wie geht es ihm, wie ist die Entwicklung etc.
…selbst aktiv für seinen Schutz werden, auf welche Art auch immer
…Botschafter für das Tier und seine Umgebung werden, Infos verbreiten etc.
…sich zu einer Gemeinschaft zusammenfinden, um Ideen und Aktionen zu diskutieren und gemeinsam umzusetzen. Das fängt bei Petitionen an und hört bei Sammelaktionen für die Erhaltung noch nicht auf. Auch die Wissenschaft könnte von solchen Gemeinschaften und dem gesammelten Wissen profitieren;
Der Rest der Reise
Wir sind immer noch auf den Brothers. Die Korallenbleiche ist hier weniger als weiter im Süden, aber der Zustand der Riffe ist trotzdem katastrophal – vor allem, wenn man in Erinnerung hat, wie es früher war. Die unglaublichen Schluchten, Canyons, Buchten, Steilwände – das macht die Schönheit dieser Tauchplätze aus. Vor allem die Porenkorallen sind hier noch tw. in Ordnung, es ist auch etwas kühler als im Süden. Am Little Brother sind mit uns 6 Schiffe, ungefähr 11 weitere am Big Brother, das ist viel, aber nicht sehr viel.
Am Abend gibt es dann das Gala-Essen. Das ist Teil jeder Safari und immer sehr nett. Diesmal wird das Abendessen am Oberdeck serviert, es gibt besonders liebevoll zubereitete Speisen und alle bekommen eine Verkleidung, was irgendwie auch ganz witzig ist.

Bild: Peter und Thomas sind für das Abendessen bereit

Bild: Links Carsten, rechts Hannes, vor allem Hannes geht als echter Ölscheich durch

Bild: Der liebevoll dekorierte Truthahn

Bild: (Matthias) Das Gruppenbild am Galaabend
Nach dem Essen genießen wir noch die Abendstimmung und freuen uns, dass wir die Brothers ohne Komplikationen betauchen durften.

Bild: Abendstimmung, dazu zwei Safariboote
An diesem Bild kann man ein wenig den enormen Energieaufwand sehen, der für den Betrieb solcher Schiffe notwendig ist. Verbrannt wird Diesel, der auch die drei Generatoren antreibt, von denen mindestens einer rund um die Uhr läuft. Das war früher anders, da wurde der Generator über Nacht abgeschaltet, eventuell notwendiges Licht oder der Strom für die Kühlschränke kam aus Batterien.
Heute geht das nicht mehr, allein die Klimaanlage würde jede Batterie sofort in die Knie zwingen. Die großen, modernen Schiffe haben einen massiv höheren Energiebedarf. Hier im Vergleich eines der früheren Safarischiffe:

Bild: Die myTala ist ca. 25 Jahre alt und wesentlich kleiner als die modernen Schiffe. Die NileSat, mit der ich meine ersten Safaris gemacht habe, war noch einmal ein wenig kleiner.
Nach den Brothers geht es auf die lange Fahrt Richtung Hurghada, die über Nacht absolviert wird und ruhig verläuft. Am letzten Tag gibt es noch zwei Tauchgänge auf Small Giftun Island, das direkt vor Hurghada liegt. Der Early Morning Dive ist nett, weil nur wenige andere Schiffe da sind. Hier gibt es fast keine Korallenbleiche, wir sind ja noch einmal einiges nördlicher, fast 350 Kilometer von unserem südlichsten Punkt. Ich bin auch erstaunt, wie sehr sich das Riff trotz der enormen Betauchung irgendwie erhalten konnte, wenngleich hier auch viel kaputt ist, keine Frage.

Bild: Guido bei einer Hirnkoralle. Die sind inzwischen recht selten und im Süden alle tot.
Danach wird es heftig. Im Minutenabstand kommen Tagesboote, manche mit Tauchschülern, die meisten mit Schnorchlern, die sie hier ins Wasser kippen. Das sind tausende pro Tag, sie kommen von den zahlreichen Hotels.

Bild: Tagesboote kommen zu Dutzenden
Dort werden diese Ausflüge mit traumhaften Bildern einer bunten Korallenwelt angepriesen, als tollstes Abenteuer von überhaupt. Softdrinks inklusive. In der Realität sieht das anders aus. Auf einem alten Kahn fährt man tuckernd und gedrängt hinaus, oft ohne Schatten, um dann eine Stunde mit vielen anderen die fast toten Riffe zu beschnorcheln.
Aber es funktioniert, die meisten Menschen sehen das scheinbar nicht dramatisch und bezahlt hat man ja auch dafür.

Bild: Die Boote lassen die Schnorchler in großen Gruppen ins Wasser. Uns Taucher stören sie eigentlich nicht, wir sind sowieso viel tiefer unten.
Der letzte Tauchgang ist dann der entspannteste, den auch nicht mehr alle mitmachen. Insgesamt sind es 17 Tauchgänge, die ich machen konnte. Die beiden anderen aus Österreich hatten auch eine entspannte Woche und lassen es sich mit einem Bier gut gehen:

Bild: Jenny und Thomas vor Small Giftun Island
Danach wird das Tauchzeug getrocknet und es geht zurück nach Hurghada in den Hafen. Auf der Fahrt sehen wir eine schöne Jacht, die vor Anker liegt. Der Kapitän fährt näher heran um sich das Schiff genauer anzusehen. Google hilft schnell bei der Identifizierung: Es ist die „George Town“ von den Virgin Islands, hat 60 Mio Dollar gekostet und ist für den Schnäppchenpreis von 1,2 Mio für eine Woche zu mieten. Platz ist für 12 Gäste.

Bild: Die Luxusjacht
Ich finde das Schiff wirklich fesch, möchte es aber weder besitzen noch damit fahren. Es zeigt die Perversion unserer Welt, die auch wir in kleinerem Umfang leben. Die Tauchreise hat mich alles inklusive ca. 2.700 Euro gekostet. Ein durchschnittlicher Ägypter verdient 200 Euro im Monat – davon kann man einigermaßen leben, meinte unser Taxifahrer. Meine Urlaubswoche hat deutlich mehr gekostet als er im Jahr verdient.
Wir verbringen den Nachmittag jedenfalls am Oberdeck, plaudern über die Woche, tauschen Ansichten aus und lassen es uns ein letztes Mal an Bord gut gehen.

Bild: Abhängen an Deck.

Bild: Omar und Hazem, unsere beiden Guides. Und weil wir zwar noch voll vom Mittagessen sind, eine Jause aber immer geht, gibt es jeden Nachmittag noch was Gutes: Kuchen, kleine Pizzastücke und noch vieles mehr. Verhungert ist hier noch niemand.
Dann sind wir im Hafen. Sofort beginnt die Crew mit dem Wechsel, Nachschublieferungen kommen, Wasser wird nachgetankt, das Schiff wird gereinigt und wir kommen uns ein wenig überflüssig vor. Alle anderen werden am kommenden Tag in der Früh bzw. am Vormittag von Bord gehen und heimfliegen – bis auf uns, wir bleiben noch einen weiteren Tag in einem Hotel gleich in der Nähe.

Bild: Transporter bringen alles, was in der kommenden Woche gebraucht wird: Jede Menge Essen, neue Wassertanks, frische Bettwäsche und noch vieles mehr.
Nach der Safari
Am Abend machen Peter und ich noch einen kleinen Spaziergang durch Hurghada bzw. durch den Teil, in dem die kleine Marina für die Golden Dolphin-Schiffe liegt. Dort reiht sich ein Riesenhotel an das nächste, wir haben für den nächsten Tag das „PickAlbatros Blu Spa“ gebucht, nicht billig, dafür „adults only“. Gleich daneben ist ein anderes Hotel der gleichen Gruppe mit riesigen Spielanlagen für Kinder.
Die Hotels gleichen einander, haben alle riesige Eingangshallen, im Stil brutalistisch-pseudoorientalisch – die geneigte Leserschaft merkt hier schon, dass ich kein Freund von Hotelaufenthalten bin.

Bild: Das Hotel von außen.
Innen sieht es auch nicht anders aus. Eine riesige Pool-Anlage mit brav germanisch reservierten Liegen, vier Restaurants und ein Strand mit weiteren Liegen. Es gibt kleine Sportanlagen und Animation für die Menschen ohne Seele (lat: anima), also für die, die nichts mit sich anzufangen wissen.

Bild: Das Hotel innen
Ich tu mir hier im Hotel auch schwer. Aber das ist ein Vorgriff, noch sind wir beim Spaziergang durch Hurghada. An jeder Ecke irgendein Laden, die Straße in grottenschlechtem Zustand, vor allem die Gehsteige sind überall aufgebrochen. Wer sich wundert, warum es hier an jeder Ecke eine Apotheke gibt: Als wir in der Dämmerung entlangmarschieren, stürzt eine ältere Dame über eine aufgebrochene Gehsteigplatte. Repariert wird hier gar nichts im öffentlichen Raum – dabei gibt es sogar ein Stück Radweg.
Was es gibt: Die Rauchkanonen um Gelsen zu töten. Ich kenne das schon von den Malediven, da sind sie alle zwei Tage herumgegangen und haben die ganze Insel ausgeräuchert. Dass da nicht nur die Gelsen zugrunde gehen, liegt auf der Hand.

Bild: Ausräuchern der wenigen Grünanlagen eines Hotels
Am nächsten Tag müssen wir um 10 Uhr von Bord, die meisten sind schon früher abgeholt worden, wir fahren die fünf Minuten mit dem Taxi zum Hotel und checken ein. Unser Zimmer ist noch nicht fertig, wir werden ins Restaurant geschickt, was okay ist.
Der Tag ist zum Vergessen, ein wenig Internetsurfen, ein kleiner Spaziergang, essen gehen.
Hurghada bietet ein tristes Bild, abgewrackte Einkaufszentren zeigen, dass nicht nur Ressorts eine kurze Existenz haben, aber auch, dass die besten Zeiten vorbei sind. Das war vor zehn bis fünfzehn Jahren, als die Russen in Horden hier eingefallen sind. Besonders beliebt waren sie nicht, ihr Geld schon. Jetzt sieht man deutlich weniger davon, sie sind aber leicht und von ferne zu erkennen, die Frauen tragen allesamt Miniröcke und haben ihre Lippen aufgespritzt wie ich es sonst nur in Horrorfilmen je gesehen habe. Gefällt ihnen scheinbar.

Bild: Ein abgewracktes Einkaufszentrum
Hier gibt es einen McDonalds, einen KFC und einen Pizza Hut. Ich spüre die gleiche Endzeitstimmung wie unter Wasser. Auch hier übernimmt das Plastik die Regie und zwar an jeder Ecke. Alles ist irgendwie künstlich, passt nicht hierher, ist nachgebildet wie die Palmen, die Lagunenlandschaft in Port Ghalib oder El Gouna.
Markus schafft es uns in sein Geschäft hineinzulocken, indem er einen besonderen Schmäh anwendet. Er kommt zu mir und fragt mich, woher ich mein T-Shirt habe. Auf die Frage nach dem Warum meint er, das Motiv interessiert ihn und ob er ein Foto machen darf.
Er darf. Und lockt uns zugleich in sein Geschäft, wo eine Stickmaschine steht. Er erklärt uns in gutem Deutsch, dass er jede Form von Stickerei schnell und günstig anfertigen kann. Nur zehn Euro für ein T-Shirt mit Stickerei.
Das stimmt natürlich nur zum Teil, denn damit ist ein billiges Shirt gemeint und eine sehr einfache Stickerei. Alles andere kostet mehr.
Mein Bruder möchte aber sowieso so etwas haben, sein Sohn Niki braucht schließlich ein Geschenk vom Urlaubsort seines Vaters. Markus ist sehr beflissen und nicht zu aufdringlich. Außerdem hat er genau was wir suchen, ich entdecke T-Shirts der Marke „Apple“. Das hat nichts mit der Computerfirma zu tun, sondern ist ein ägyptischer Kleidungshersteller, der seine Fabrik in Kairo hat und hervorragende Qualität erzeugt. Ich habe mir vor vier Jahren im Sudan auf der „Seawolf“ einen Sweater gekauft, von dessen Verarbeitung ich restlos begeistert bin. Außerdem hat die ägyptische Baumwolle einen guten Ruf.
Ich erfahre von Markus, dass es die Marke nirgends im Internet gibt – sie wird nur direkt vertrieben. Glücklicherweise hat er genau den von mir gesuchten Sweater, sogar in einem hellen Blau, das mir sehr gut gefällt. Eine Jogginghose für daheim suche ich auch und werde ebenfalls fündig. Ich gehe höchst ungern „shoppen“ und bin daher erfreut über diese tolle Gelegenheit, damit habe ich nicht gerechnet.
Peter sucht sich Shirts für Niki aus und die passende Stickerei. Wir werden uns handelseins und Markus meint, er würde die fertigen Shirts noch in der Nacht ins Hotel liefern.
Wir bezahlen und hoffen, dass er sein Wort hält. Er heißt übrigens nicht Markus, sondern eher Ali oder Mohammed, aber für uns Touristen klingt Markus besser.
Am nächsten Tag werden wir von einem am Abend gebuchten Taxi abgeholt und zum Flughafen geführt. Markus hat Wort gehalten, die T-Shirts sind da und gut gearbeitet.
Der Taxifahrer spricht sehr schlecht Englisch und fragt uns zu welchem Terminal wir müssen. Wir meinen, zur Air Cairo, die nach Wien fliegt. Er führt uns zu Terminal 1, wir steigen aus und er fährt weg.
Dann entdecken wir, dass wir doch beim falschen Terminal sind. Glücklicherweise steht da noch ein anderes Taxi, dessen Gast sich gerade verabschiedet. Ich laufe hin und erkläre ihm unsere Situation. Er meint, das wäre kein Problem, er führt uns sofort zum anderen Terminal.
Im Gegensatz zu seinem Vorgänger kennt er sich aus und so landen wir dort, wo wir hingehören. Jetzt hat die Fahrt halt das Doppelte gekostet.
Das Anstellen ist knechtend wie immer, lange Schlangen, dazwischen elende Wartezeiten. Beim Security-Check nehmen sie mir alle Batterien für die Tauchlampen ab, weil man darf normale Batterien nicht im Handgepäck transportieren, Lithium-Ionen-Batterien jedoch muss man im Handgepäck transportieren. Beim Hinflug war das kein Problem und ich hasse Fliegen wie die Pest.
Irgendwann sind wir dann im knallevollen Flugzeug, es wird eng und ich hoffe, dass die Zeit irgendwie vergeht.
Nach ca. vier Stunden sind wir in Wien und nach neuerlichem Stress mit der Taxifirma (der Fahrer meint, er wäre gleich da, was nicht stimmt, er ist noch irgendwo, kommt aber bald, angeblich etc.) bin ich dann daheim.
Ein sehr durchwachsener Urlaub ist zu Ende, was sich gut anfühlt. Vielleicht war das meine letzte Tauchreise, wer weiß das schon.