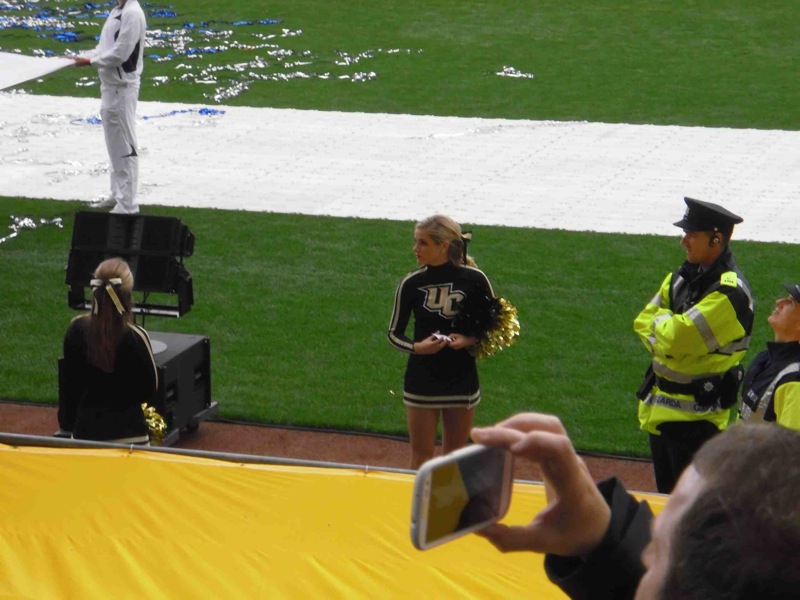Meine innere Uhr stellt sich als zuverlässiger heraus als der Wecker, der schlicht und einfach nicht läutet. Es ist 03.59 Uhr und wir trinken einen schnellen Tee. Die am Vortag im Sarit Center gekauften Donuts stellen sich als steinhart heraus, aber ich habe sowieso keinen Hunger. Erstens ist es zu früh, zweitens hat sich doch ein gewisses Reisefieber eingestellt und drittens will ich einfach nur weg. Jede Minute ist eine Verzögerung, von der wir nicht wissen, ob sie sich nicht am Ende bitter rächt.
Schließlich schaffen wir es um 04.40 tatsächlich beim Tor hinaus zu fahren und die kühle, aber angenehme Nachtluft empfängt uns. Es ist ein Erlebnis der anderen Art Nairobi um diese Zeit zu durchqueren und es geht unglaublich schnell.
Zu allem Übel ist uns am Abend noch der Blinker ausgefallen. Wir haben zwar noch am Relais gerüttelt und die Sicherung angesehen, aber wir konnten auch mit Luis Hilfe den Blinker nicht reparieren.
Das ist zwar unangenehm, aber es muss halt ohne gehen.
Um Punkt fünf Uhr fahren wir über den letzten Kreisverkehr am Uhuru-Highway und verlassen Nairobi. Wir haben noch mehr als 1,5 Stunden Fahrt in der Dunkelheit vor uns – etwas, das man nur mit viel Routine auf Kenias Straßen tun sollte. Zu viele Wahnsinnige und Betrunkene sind in der Nacht unterwegs und die Straßen halten das eine oder andere Schlagloch oder sonstige Überraschungen bereit.
Nun wird es spannend: wie viel LKW-Verkehr wird es geben? Wir haben die Information, dass die LKW erst bei Sonnenaufgang Richtung Mombasa aufbrechen. Das stellt sich als grundfalsch heraus, sie fahren die ganze Nacht. Wir befinden uns auf der Hauptverkehrsroute von Mombasa Richung Uganda und manchmal treffen wir auf ganze LKW-Kolonnen.
Das ist mühsam und stressig, denn man muss sie überholen. Viele fahren gerade mal 30 km/h – manche, weil sie nicht schneller können, andere aus welchem Grund auch immer.
Wir haben ein linksgesteuertes Auto und in Kenia ist Linksverkehr. Überholen ist – wenn überhaupt – nur mit einem entsprechend guten Beifahrer möglich, im Idealfall ist man exzellent aufeinander eingespielt.
Da Thomy und ich seit 2000 nun schon das fünfte Mal gemeinsam unterwegs sind, wissen wir wie es läuft: „Langsam raus“ heißt, dass ich etwas nach rechts fahre, so dass Thomy sieht, ob etwas entgegen kommt. „Steig drauf“ heißt: raus und Vollgas!
So kann man ganze Kolonnen überholen, aber es ist sehr sehr anstrengend und nicht ungefährlich: es kann jederzeit ein Auto aus einem Querweg kommen oder ein gerade Überholter schert aus – das Schreckensszenario ist breit gefächert.
Dazu kommt die dauernde Hoffnung, dass es irgendwann weniger LKW werden, leider bleibt sie lange Zeit unerfüllt.
Die Straße ist sehr gut und hat auf beiden Seiten eine Art Pannenstreifen, der jedoch sehr schmal ist und den man vor allem in der Dunkelheit nicht befahren sollte. Es kann jederzeit ein Radfahrer auftauchen oder ein Moped, beide natürlich unbeleuchtet. Oder ein LKW hat eine Panne oder ist aus sonst einem Grund am Rand abgestellt. Auch er unbeleuchtet. Es gibt in Kenia auch nur selten Pannendreiecke. Wer eine Panne hat, reisst ein paar Zweige vom nächsten Baum und dekoriert die Gefahrenstelle rund um das Auto. Wenn es der Fahrer schlau macht, dann legt er noch ein oder zwei Zweige hinter die nächste Kurve.
Die Mombasa-Road ist ab Nairobi eine längere Zeit ziemlich bergig und unübersichtlich. Das ist besonders in der Nacht eine Herausforderung, ich habe sie jedenfalls wesentlich gerader und lang nicht mit so viel auf und ab in Erinnerung. Damals war natürlich wesentlich weniger Verkehr, allerdings war auch die Straße in einem schlechteren Zustand.
Thomy reicht mir immer wieder mal die Wasserflasche, ansonsten machen wir längere Zeit keine Pause. Es ist eine Horrorvorstellung, dass bei einer Pause all die LKW, die wir gerade mühsam überholt haben, wieder an uns vorbei fahren.
Es sind viele LKW, eigentlich sogar sehr viele. Manchmal gibt es ein oder zwei Minuten eine leere Strecke, aber dann fährt man auf die nächste Kolonne auf. Dafür halten die Reifen und wirken sehr vertrauenserweckend. Das beruhigt uns ein wenig.
Dann dämmert es langsam, im Osten zeigt sich ein oranger Lichtschimmer und langsam wird es hell. Das verändert alles, denn jetzt sind die Autos sichtbarer und auch der Straßenrand wird besser überschaubar. So ist das Fahren ein bisschen weniger anstrengend, aber wir haben nach zwei Stunden Fahrt noch immer nicht allzu viele Kilometer zurück gelegt. Die Straße wird jetzt auch flacher, wir kommen langsam aus den Bergen in die Ebene. Leider habe ich keine Augen für die teilweise grandiose Landschaft, der Verkehr verlangt volle Konzentration.

Bild 98: Morgenröte
Irgendwann machen wir eine kurze Pinkelpause und essen zwei Bananen, doch dann treibt uns der Zeitdruck voran und wir hoffen bald die Hälfte des Weges geschafft zu haben.
Besonders gefährlich sind die Overland-Busse. Das sind riesige Fernbusse, in denen jede Menge Menschen sitzen und vorne ein irrer Fahrer. Die Fahrer von Overland-Bussen sind allesamt irre, ich darf das sagen, weil ich hatte mit ihnen zu tun, in diesem Fall 500 Kilometer lang.
Wenn sie entgegenkommen und überholen, dann bleiben sie einfach draußen. Du siehst, dass sich das nicht ausgeht und realisierst: zurück kann er nicht mehr und wenn er am Gas bleibt, geht sich das nie und nimmer aus. Keine Chance, niemals!

Bild 99: LKW überholen
Was tun? Du hast eigentlich keine Zeit um eine Entscheidung zu treffen, sondern musst einfach handeln. Das bedeutet, du musst rechtzeitig seinen Überholvorgang bemerken und sofort runter vom Gas gehen, manchmal auch bremsen. Wenn du langsam genug bist, schleichst du dich nach links runter von der Fahrbahn. Sofern dort etwas ist, wo du dich hinschleichen kannst.
Dann donnert er vorbei und du kannst deine Fahrt wieder fortsetzen. Die Fahrer wissen genau, dass sie stärker sind und können dich damit zwingen von der Straße zu weichen. Wer das mit 80 probiert, ist wahrscheinlich um ein paar Überschläge reicher.
Ich möchte nirgends auf der Welt einen Unfall haben, aber hier ganz besonders nicht. Es gibt zwar eine Ambulanz, aber ob die kommt und wann und was die dann mit dir tut oder wohin sie dich bringt, das findet man besser nicht heraus.
Somit ist vorausschauendes Fahren das Gebot der Stunde und für uns des ganzen Tages.
Dann erreichen wir den Tsavo-Nationalpark, den die Mombasa-Road in „Tsavo East“ und „Tsavo West“ teilt. Der Park ist der größte in Kenia und besteht aus einer einzigen, riesigen Ebene. Für Safari kann ich ihn nicht so wirklich empfehlen, trotzdem ist er beliebter Zielort für billige Safaris von Mombasa aus.
Hier entdecken wir auch das nächste Großprojekt. Ich weiß nicht was die Chinesen hier bauen, aber es wird gewaltig. Sie schütten Unmengen rote Erde zu einer hohen, breiten Trasse auf, die neben der Straße verläuft. Wird das ein neuer Mombasa-Highway? Die Menge des Verkehrs würde das erfordern. Auf jeden Fall wird hier eine Unmenge an Material bewegt.
Leider setzt Kenia voll auf den Autoverkehr. Die alten Bahnverbindungen wurden entweder stillgelegt oder sie werden wenig benützt. Wir sehen auf der gesamten Strecke gerade mal einen Güterzug mit Containern, der Rest fährt auf der Straße. Dass die Eisenbahnstrecke nicht elektrifiziert wurde, brauche ich nicht extra erwähnen.
Immer wieder stehen am Straßenrand Crash-Denkmäler. Das sind vollkommen zerstörte Unfallautos, die auf ein Podest gestellt werden, meist garniert mit einem Sinnspruch gegen Raserei.
Ich schätze, dass die genauso viel wirken wie die Warnhinweise auf Zigarettenpackungen. Wir jedenfalls sind uns der Gefahren durchaus bewusst und fahren mit 80, maximal 90 Richtung Mombasa.
Irgendwann erreichen wir Mtito Andei, dann Voi und jetzt wird es punkto Tanken interessant. Wir dürfen maximal 25% Tankinhalt haben, wenn wir das Auto abgeben. Also gilt es die Liter zu berechnen, denn wir wollen noch genug Sprit für meinen Bruder drin lassen, vor allem, weil der hier ja deutlich billiger ist als in Europa. An jedem Stop sieht man natürlich LKW ohne Ende.

Bild 100: LKW
Die erste Tankstelle, die wir ansteuern, hat keinen Diesel. Die zweite hat zwar Diesel, aber eine lange Warteschlange. Wir stellen uns hinten an und beobachten, wie die LKW, die wir gerade mühsam überholt haben, an uns vorbei ziehen, einer nach dem anderen. Kurz bevor wir an der Reihe sind, meint der Tankwart, dass der Diesel leider aus wäre.
Glücklicherweise ist gleich daneben noch eine weitere Tankstelle und sie haben Diesel, dafür aber keine Warteschlange.
Irgendwann verändert sich die Straße und wird schlechter. Das ist jetzt die Mombasa-Road, wie ich sie von früher kenne: eng und mit Schlaglöchern.
Besonders prickelnd wird es, wenn man einen LKW überholt, der genau dann einem Schlagloch ausweicht. Da es viele LKW gibt und auch jede Menge Schlaglöcher und alle LKW allen Schlaglöchern ausweichen, fahren wir etliche Kilometer Schlangenlinie. Das ist noch anstrengender als sonst und ich merke, wie die 7 Stunden fahrt ohne nennenswerte Pause langsam an meinen Kräften zehren. Auch Thomy geht es nicht viel besser, denn er muss sich fast genauso konzentrieren. Wir merken es daran, dass wir langsam aggressiv werden und uns gegenseitig da und dort sinnlose Vorwürfe machen.
Glücklicherweise sind wir ein wirklich gut eingespieltes Team und können diese kleine Krise bewältigen.
Irgendwann wird die Ebene noch flacher und wir ahnen, dass Mombasa nicht mehr fern ist. Die Landschaft hat sich auch verändert, seit einiger Zeit sieht man die berühmten Baobab-Bäume und es wird auch ständig heißer.

Bild 101: Baobab-Bäume
Dann ist es soweit, wir merken, dass wir uns Mombasa annähern, weil der Verkehr dichter wird. Er wird sogar sehr dicht und wir fahren langsam durch die Vororte. Diese sind im Laufe der letzten zwanzig Jahre sehr gewachsen und so dauert es relativ lang.
Wir sind trotzdem guter Dinge, denn es ist erst 12.30 Uhr und wir haben noch genügend Zeit um Mombasa zu durchqueren.
Das stellt sich allerdings als gar nicht leicht heraus. Wir befinden uns in einer Art Donnerstag-Mittag-Stau und der ist nicht von schlechten Eltern: LKW, Minibusse, PKW und jede Menge Motorräder und natürlich Tuk-Tuks. Das sind die kleinen Motor-Rikschas, die aus dem asiatischen Raum kommen und ursprünglich in Italien erfunden wurden. Dort hat sie die Firma Piaggio als „Ape“ gebaut, als Lastendreirad, das auch menschliche Last befördern kann.
Hier haben sie sich auch durchgesetzt und es gibt Millionen davon. Sie haben kleine, nicht allzu abgasfreundliche Zweitakter, sind robust und mit sehr einfacher Technik ausgestattet. Die Fahrer sind so wie die meisten Taxifahrer bei uns nicht die Eigentümer der Tuk-Tuks. Sie drängen sich in jede kleinste Lücke und sind wahre Meister im Lückenfinden. Selbst wenn es beim besten Willen keine Lücke mehr gibt, ist noch Platz für ein Tuk-Tuk. Oder auch zwei. Bei drei ist dann allerdings wirklich Schluss, vor allem, nachdem sich das vierte und fünfte hineingedrängt hat.
Wir bewahren die Nerven, unser Toyota hat vorne einen Rammschutz, der auch von Tuk-Tuk-Fahrern problemlos respektiert wird.

Bild 102: Stau in Mombasa
Nach langer Zeit im heißen Auto kommen wir bei einem Gebäude an, das uns als Treffpunkt von Frank genannt wurde. Leider kann man davor nicht anhalten und schon gar nicht parken, daher fahren wir einmal rundherum bis an die Rückseite des Hauses. Dort befindet sich eine kleine Straße, in der wir provisorisch parken können. Das ist zwar sicher nicht erlaubt, aber wir sind müde, erschöpft, durstig und verschwitzt. Wir bleiben hier jetzt einfach stehen. Sie können uns ja wegtragen, wenn sie wollen.
Es kommt aber niemand und die Wächter des Parkhauses daneben meinen nur, wir sollten zwei Meter weiter nach vorne fahren, dann kämen alle Parkenden vorbei und niemand hätte ein Problem damit.
Ich rufe Frank an und er meint, er wäre in zwanzig Minuten da. Ich rechne daher nicht vor einer halben Stunde mit ihm, eher in 45 Minuten.
Es ist heiß und wir finden glücklicherweise heraus, dass doch noch etwas Wasser im Tank ist. Einmal Banane essen und Hände waschen löst durchaus Entzücken aus. Noch viel schöner wäre es allerdings, wenn uns Frank nicht warten ließe, inzwischen ist eine knappe Stunde vergangen und ich frage mich, warum wir wie die Verrückten LKW überholt haben, wenn wir jetzt in einer staubigen, heißen Nebengasse auf Frank warten müssen.
Ich rufe ihn an und er meint, er wäre gleich da und wo wir denn seien.
Na, auf der Rückseite des ausgemachten Hauses, exakt auf der Rückseite, nicht zu verfehlen. Was soll die Frage?
Frank meint, dass alles klar wäre und ich ihm noch die Autonummer sagen solle, damit er anhand des Autos uns finden könne.
Ich denke mir, dass ich es mit einem Irren zu tun habe. Was ist an „Backside“ nicht verständlich? Der Idiot wird wohl in der Lage sein die Rückseite eines ihm gut bekannten Hauses zu finden. „Backside, do you know what a backside is?“ frage ich ihn und er bejaht.
Dann fragt er noch einmal nach der Autonummer und ich beschließe, ihn langsam zu meucheln, vorausgesetzt er kommt auf die Backside.
Frank dürfte ein gutes Gespür haben und beschließt sich dumm zu stellen. Ich schicke Thomy aus um ihn zu suchen, was vor allem deswegen schwierig ist, weil wir ja keine Ahnung haben wie der Typ aussieht. Okay, er dürfte Afrikaner sein, aber das reicht hier als Erkennungsmerkmal nicht wirklich aus.
Ich rufe ihn noch einmal an und frage ihn, wo er denn sei, denn wir würden bei ihm vorbei kommen, egal wo er ist, das wäre einfacher.
Er meint, dass er fast bei uns wäre, es könne sich nur mehr um Augenblicke handeln. Ich glaube ihm kein Wort und bestehe darauf, dass er mir verrät, wo er sich aufhält. Hätte ich jetzt eine Cruise Missile und seinen Standort, er wäre geliefert.
Leider habe ich weder das eine noch das andere und so überlebt Frank diesen Tag. Irgendwann reiche ich entnervt dem netten Parkwächter das Handy und er verspricht, dem wahnsinnigen Frank zu erklären, wo wir denn seien.
Das funktioniert tatsächlich und Frank taucht auf. Ich bin glücklich und beschließe, ihn ein anderes Mal zu lynchen.
Sein Office ist nur wenige Schritte entfernt, wir fahren trotzdem mit dem Auto hin und parken uns auf der Straße ein.
„Hatschieh“ ist der übliche Gruß in Häusern mit Klimaanlage. Wir betreten genau so ein Haus und werden auf der Stelle schockgefroren. Ich halte so etwas nicht sehr gut aus und hasse daher Klimaanlagen. Draußen hat es 36 Grad, herinnen 16 – das ist nicht lustig.
Wir werden seinem Chef vorgestellt und ich hoffe, dass jetzt alles gut und reibungslos verläuft. Wir überreichen das Carnet und er macht ein paar Telefonate.
Dann erfahren wir, dass alles soweit okay sei und wir nun bestimmte Kosten begleichen müssten. Das ist okay, denn darauf hat mich mein Bruder vorbereitet. Frank meint, dass wir das Auto dann in zwei Tagen abliefern sollten.
Moment, Halt, Stop: es war ausgemacht, dass wir das Auto heute abliefern. Erstens wollen wir nicht mehr damit herumfahren, zweitens sind wir wie zwei Wahnsinnige gerade acht Stunden über eine der gefährlichsten Straßen der Welt gefahren, nur um hier zu erfahren, dass wir erst in zwei Tagen da sein müssten?
Ich beschließe, meine Mordpläne wieder auszupacken. Frank beruhigt und meint, ihnen wäre es nur um das Original des Carnets gegangen, das Auto wäre sozusagen egal.
Frank hat Glück an diesem Tag, großes Glück sogar. Ob er das weiß?
Wir erklären ihm unmissverständlich, dass wir genau original keinen Meter mehr mit dem Toyota fahren würden. Das überzeugt ihn und er meint, wir müssten dann nur drei Tage Parkgebühr zahlen, das wären 1.050 Khs, also umgerechnet zehn Euro.
Außerdem würde er uns gerne das Carnet zukommen lassen und zwar durch einen Boten. Das wäre deswegen möglich, weil der Zoll das Carnet nicht mehr brauchen würde, nämlich ab Morgen Nachmittag.
Wir vereinbaren, dass er es gleich direkt an meinen Bruder in Österreich schickt, was noch einmal 50 Dollar kostet.
Dann passiert das Unerwartete: Frank meint, wir wären fertig. Wir müssten nur noch die persönlichen Sachen aus dem Auto holen und dann würde er uns helfen ein Taxi zu finden, das uns nach Kilifi führt.
Ich hatte schon mehrfach mit Johanna telefoniert, sie erwartet uns schon und hat uns außerdem verraten, dass wir ins „Bofa Beach Resort“ gehen sollten, das würde sie kennen und es wäre sehr nett.
Wir holen unsere Taschen aus dem Toyota und ich schenke einem der Parkwächter meine Schuhe. Vielleicht passt er ja dann besser auf das Auto auf, einen Versuch ist es wert.
Frank organisiert uns ein Tuk-Tuk, mit dem wir zum Taxi fahren können. Es gibt zwei verschiedene Größen von Tuk-Tuks und wir brauchen ein größeres, das auch nach kurzer Zeit verfügbar ist.
Die Tuk-Tuks bestehen eigentlich nur aus lackierten Rohren mit einem Motor und glücklicherweise einer Plane, die vor der Sonne schützt. Sie sind billig, aber einen Unfall darf man damit auf keinen Fall haben.
Wir erreichen die Taxi-Firma und erklären, dass wir nach Kilifi wollen. Ich habe von Johanna in weiser Voraussicht den üblichen Fahrpreis erfragt und kann daher verhandeln, denn sie wollen 7.000 KHS bis nach Kilifi und ich weiß, dass wir maximal 5.000 zahlen müssen. Einige Leute stecken einige Zeit die Köpfe zusammen und raunen Dinge, die ich nicht wissen will. Dann kostet es auf einmal 5.000 Khs und wir marschieren los zum Auto.
Der Fahrer heißt „Amos“ und hat die üppigste Unterlippe, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Er hat außerdem eine sehr tiefe Stimme und spricht langsam und nicht sehr laut. Aber er ist ein guter Fahrer und wir genießen es sehr, nicht selbst fahren zu müssen.
Natürlich ist auch jetzt sehr viel Verkehr und Amos kämpft sich durch.
Mombasa hört im Norden an der Küste nicht einfach auf, sondern es setzt sich in kleinen, aneinander gereihten Orten fort. Es gibt nur eine Küstenstraße und sie ist überlastet. Wir fahren an den ersten Hotels vorbei, die irgendwie alle den Namen „Beach“ haben. Wir müssen aber noch weit in den Norden, ca. 80 Kilometer. Amos fährt bedächtig und wir haben es nicht sehr eilig. Ich war noch nie hier an der Nordküste von Mombasa und sauge die Eindrücke auf.
Nach etwa zwei Stunden Fahrt kommen wir in Kilifi an. Rechts an der Küstenstraße entlang, gleich müssten wir da sein.
Dann biegen wir links ab und Thomy ist enttäuscht, denn er hat sich ein Hotel direkt am Strand erwartet, mit weißem Sandstrand, Palmen und jeder Menge Gin Tonics, die ihm an den Liegestuhl serviert werden.
Das Bofa Beach Resort liegt auf der anderen Seite der Straße und hat nur ein kleines Swimmingpool. Die Anlage ist nett, aber unspektakulär und die Dame, die uns empfangt, ist nicht allzu motiviert.
Wir bekommen ein Zelt und bemerken, dass wir die einzigen Gäste sein dürften. Ich bin fix und foxi und falle erst mal ins Bett, um ein wenig auszuruhen.
Unser Quartier besteht aus einem riesigen Zelt mit zwei großen Betten, von denen das eine leider viel zu kurz ist und selbst mit Querliegen eigentlich nicht bequem. Es gibt gute Moskitonetze und die Duschen sind auch in Ordnung.
Thomy sucht den Strand und findet ihn nicht. Das hat einerseits damit zu tun, dass es hier keinen breiten, klassischen Strand gibt und zweitens damit, dass gerade Flut ist.
Das frustriert ihn über die Maßen und er meint, wir sollten hier schnellstens wieder abhauen. Ich beschwichtige und meine, dass wir heute genau überhaupt nirgends mehr hinfahren würden und morgen könnten wir das dann diskutieren.
Heute brauchen wir noch ein gutes Essen und ein gutes Bett.
Während ich Johanna anrufe, organisiert Thomy sich ein Gin Tonic. Also er versucht es, leider haben sie an der Bar zwar Gin, aber kein Tonic. Daher kauft er eine kleine Flasche Gin in der Hoffnung, dass wir irgendwo noch Tonic auftreiben würden.
Wir fahren zu Johanna ins Pub. Das liegt in Tuk-Tuk-Reichweite und ist irgendwie ganz anders, als wir es uns vorgestellt haben. Es liegt nämlich nicht am Strand, sondern ein paar hundert Meter im Hinterland. Nach einer eher abenteuerlichen Fahrt quer um etliche Häuser auf Wegen, die in der Regenzeit eher nicht befahrbar wären, erreichen wir das „Danube Pub“, fühlen uns allerdings nicht wie an der Donau.
Johanna ist sehr nett und freut sich riesig über Besuch aus Österreich. Ich habe eine Kiste mit hausgemachten Marmeladen quer durch Afrika transportiert und kann diese jetzt los werden.
Das Pub ist geschmackvoll eingerichtet und wir bestellen Oktopus und Curry. Als das Essen kommt, sind wir mehr als nur positiv überrascht. Wir bekommen so ziemlich das beste Essen, das ich in Afrika je gegessen habe. Die Portionen sind riesig und die Beilagen exzellent. Wir können alles mit einem guten, kalten Tusker runterspülen und unseren Bärenhunger befriedigen.
Dann sitzen wir satt im Pub und tauschen Geschichten mit Johanna und ihrem afrikanischen Mann Evan aus. Er hat das Pub selbst gebaut, vor allem hat er den tiefen Brunnen geschlagen, den alle anderen rundherum nicht haben. Das führt leider zu Neid bei den Nachbarn, denn sie hätten alle gerne so einen Brunnen, der Zugang zu frischem Wasser ermöglicht.
Dieses fließt in Form eines kleinen Baches rund um das Lokal und ist viel weniger kitschig als man es sich genau jetzt vorstellt.
Wir plaudern bis lange in die Nacht hinein und nehmen uns dann ein Tuk-Tuk zu unserem Quartier.
Der bisher längste und anstrengendste Tag neigt sich dem Ende zu.