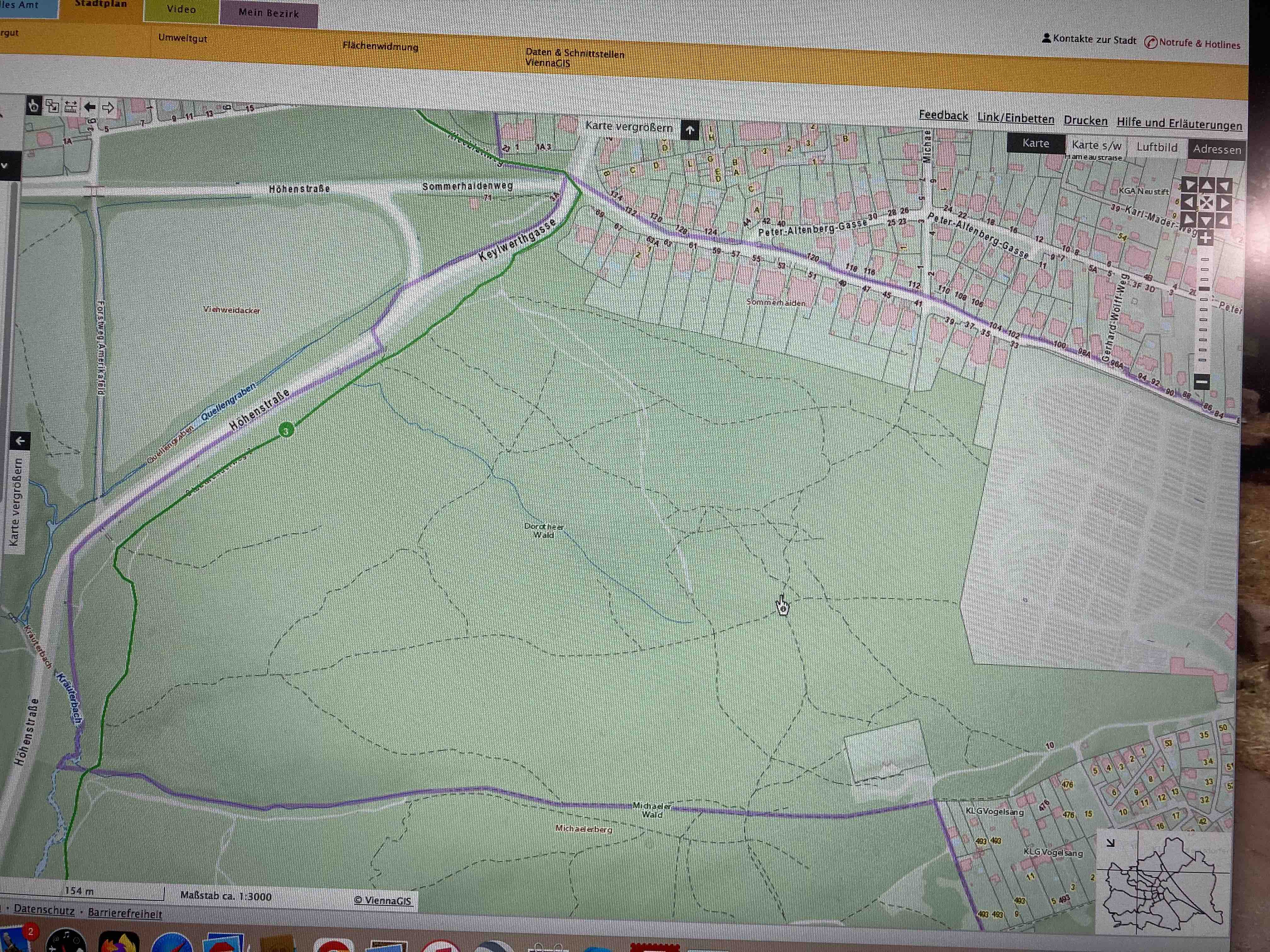Ein Versuch einer Kulturtheorie
Okay, eine ganze Kulturtheorie wird es wohl nicht, aber ein Versuch einige wichtige Elemente zu finden und aus deren Kombination ein Gesamtbild zu formen.
Ein Phänomen ist sie auf jeden Fall, die Taylor Swift.
In der Schweizer TV-Sendung Sternstunde Philosophie („Taylor Swift – die Utopie des Normalen“) wird das Phänomen vom Medienwissenschaftler Jörn Glasenapp, Autor des Buches „Taylor Swift“ (wie sollte es auch sonst heißen) gemeinsam mit der Kulturwissenschaftlerin Christine Lötscher untersucht. Ihre Diskussionspunkte und Erkenntnisse fließen in meine Überlegungen ein.
Ich versuche es zuerst in einzelnen Punkten zu erfassen.
a.) Quantität/Dimension
Sie schlägt alle Kassenrekorde, Preiserekorde, Stadionrekorde und noch einige mehr. Sie ist in einer neuen Dimension im Geldverdienen und Erfolg haben. Auf Instagram hat sie 283 Millionen Follower und bei ihrer 2024 aktuellen Konzerttour angeblich bereits mehr als eine Milliarde Dollar verdient.
b.) Qualität/künstlerisches Schaffen
Auch hier ist sie in der Branche Popmusik führend. Das ist unter anderem deswegen interessant, weil sie aus der amerikanischen Country-Szene stammt und dort nicht an der Spitze ist.
Sie spielt bzw. spielte aber in der oberen Liga mit, war eine der Laudatorinnen von Brooks & Dunn („The Last Rodeo“, Youtube) und in der Szene sehr bekannt.
Diese ist sicher die härteste Musikszene der Welt, da sie riesig ist und eine unglaubliche Vielzahl von Talenten aufweist. Wenn wir uns nur auf die Frauen beschränken, dann finden wir die Wurzeln im Dreigestirn Dolly Parton, Linda Ronstadt und Emmylou Harris (über die ich zur Country Music gekommen bin). Da reden wir von den 1970er- und 1980er Jahren. Danach kam Shania Twain, gefolgt von Reba McEntire, Martina McBride und zahllosen anderen. Die nächste Generation stand und steht immer schon in den Startlöchern, hervorzuheben sind Jennifer Nettles, Miranda Lambert und natürlich Carrie Underwood. Und auch sie sind schon die ältere Generation, neue Talente wie Kelsea Ballerini tauchen auf.
All diese Sängerinnen haben ein breites Spektrum, schon Emmylou Harris kam aus der Folk-Music und Linda Ronstadt war auch vielseitig unterwegs. Sie alle zeichnen sich durch ausgesprochen gute Stimmen aus, die meisten durch musikalisches Talent, dazu sind sie sattelfest auf der Bühne und durch die Bank attraktive Frauen.
Das ist aber noch nicht alles. Im Gegensatz zu anderen Szenen kooperieren sie gerne und es wirkt auch nicht aufgesetzt. Sie scheinen sich Erfolge zu gönnen und zeichnen sich durch professionelles Verhalten und harte Arbeit aus. Das beste Beispiel ist wohl Carrie Underwood, die in der Talenteshow „American Idol“ entdeckt wurde und bei der man die musikalische Entwicklung gut verfolgen kann.
In dieser Szene konnte sich Taylor Swift auf allen Ebenen behaupten, musikalisch, vom Auftritt und auch der Professionalität, ohne die sie lange nicht dort wäre, wo sie heute ist.
Ihr künstlerisches Schaffen beschränkt sich nicht auf das Schreiben von Liedern, sie formt ganze Alben mit speziellen Themen, zeigt Vielfalt und Kreativität.
c.) Erscheinung und Professionalität
Wenn sie wo auftaucht, bekommt sie sofort Aufmerksamkeit – sie betritt keinen Raum, sie erscheint. Das mag zu einem Teil aus der Popularität stammen, geht aber darüber hinaus. Ich formuliere es vorsichtig: Sie wird zu dem gemacht, was sie jetzt ist. Sie kann es aber scheinbar gut verkraften, wirkt nicht überfordert oder ausgebrannt.
Hier ein Link zu einem langen Interview bei einer US-Show. Hier ist gut zu erkennen wie sie sich selbst darstellt:
Sie ist so hoch auf der Karriereleiter und so tief in ihrem Business, dass das ohne Professionalität nicht möglich wäre. Entsprechendes körperliches und mentales Training ist in dieser Liga absolute Notwendigkeit, ebenso wie die dazugehörende Disziplin.
d.) Das Stretching
Unerreichbare Pop-Queen und lustiges Mädchen von nebenan. Wer sich zwanzig Minuten einer großen Show ansieht und danach zwanzig Minuten eines kleinen Konzerts, kann verstehen, was damit gemeint ist. Es sieht nach zwei verschiedenen Menschen aus und doch ist die Identität stets da.
Sie ist das „All American Girl“, kommt aus der Normalität (was auch immer man damit bezeichnen mag) und schafft es bis ganz nach oben.
Auf Youtube findet man natürlich jede Menge Videos, eines möchte ich aber besonders empfehlen, weil es Taylor Swift von einer Seite zeigt, die man in den Medien normalerweise nicht mitbekommt. Sie spielt in einer Art Wohnzimmerkonzert vier Nummern, durch die Geschichten, die sie erzählt, zeigt sich aber die Breite, die Tiefe und auch ihr Humor. Und die dritte Nummer ist diejenige, von der Lötscher und Glasenapp meinen, sie wäre ihre beste.
Hier der Link:
e.) Die Frau
Ganz zu Beginn der großen Laufbahn verkörpert sie in „Love Song“ eine Prinzessin, die vom feschen Prinzen umworben wird. Dort wird sie bereits ikonenhaft dargestellt: hübsches Gesicht, blonde Frisur, makellos-schlanker Körper.
Hier der Youtube Link:
„Man kann als Mädchen zur Frau werden ohne an Lebendigkeit einzubüßen“ heißt es in der Sendung. Dadurch wird Taylor nicht nur zum Vorbild für viele junge Mädchen, sie gibt auch dem Feminismus einen neuen Kick.
Sie muss nicht zum Mann werden, um Erfolg zu haben. Sie muss sich den Männern nicht beugen, nicht einmal scheinbar übermächtigen Konzernen. Sie macht ihr Ding und lässt alle oder zumindest fast alle Männer einfach hinter sich. Sie schlägt sie dort, wo es ihnen am meisten weh tut: bei Geld und Ruhm.
Als ihre Plattenfirma abhob und versucht hat sie zu hintergehen, hat sie sich erfolgreich gewehrt und einige Alben einfach noch einmal aufgenommen. Besonders nett ist an dieser Geschichte der Aspekt, dass sie mit den neuen Alben wesentlich mehr Erfolg hat als mit den alten.
Sie ist kämpferisch, sicher auch in gewisser Weise machtbewusst, zugleich wirkt sie durchaus nahbar, verletzlich und strahlt Freude an dem aus, was sie tut.
Seit einiger Zeit hat sie auch einen interessanten Mann gefunden, den NFL-Footballstar Travis Kelce. Der ist mehrfacher Superbowlsieger und ein echtes Raubein, als Paar sind sie zudem noch erfolgreicher als alleine. Nur durch die Verbindung gab es in der NFL einen deutlichen Entwicklungsschub, der sich nicht nur durch eine wachsende Fangemeinde auszeichnet.
f.) Die Selbstironie
Das alles geht nicht ohne Selbstreflexion. Sie zeigt, dass sie sich ständig mit ihrer eigenen Biographie auseinandersetzt. Das macht sie flexibel nach oben bzw. nach vorne. Sie kann sich selbst immer wieder neu erfinden und doch mit sich ident bleiben. Das macht sie widerstandsfähig – eine Eigenschaft, die sie gut brauchen kann und auch in Zukunft noch brauchen wird, wenn sie der raue Wind der Politik erfasst.
g.) Der politische Mensch
Sie ist möglicherweise der einzige Mensch, der eine zweite Präsidentschaft von Donald Trump verhindern kann. Dass sie oft mit ihrem Privatjet herumfliegt und dabei nicht gerade ein Umweltschutzvorbild ist, sei ihr vor allem dann verziehen, wenn sie den ganz großen Hebel zieht und die Welt vor weiteren vier Jahren Umweltdesaster schützt. Bis auf die Klimawandelleugner haben auch schon so ziemlich alle kapiert, was Trump anrichten wird, sollte er die Wahlen gewinnen.
Taylor geht einen interessanten Weg. Sie ist immer ein wenig hinter den politisch aktiven Kolleg:innen, hat sich erst 2018 zu den Mid-Terms politisch geoutet und nicht schon ein Jahr vorher bei Trumps erster Präsidentschaft.
Sie versucht auch nicht in die Links-Rechts-Spaltung hineinzugeraten, sondern sieht sich eher auf der Seite der Vernünftigen, Normalen – vielleicht in der Hoffnung, dass das eine Mehrheit ist, die auch vernünftig und normal wählen kann.
Derzeit ist es ja nicht besonders leicht Fan von Demokraten oder Republikanern zu sein. Die beiden Kandidaten wirken wir die Wahl zwischen Pest und Cholera. Taylor hat bereits im Frühjahr 2024 etwas Wichtiges getan: Sie hat ihre Fans aufgerufen sich registrieren zu lassen. Das ist eminent wichtig, denn nur rechtzeitig Registrierte haben überhaupt das Recht zu wählen.
Da sie derzeit ca. 300 Millionen Menschen in ihrer Fangemeinde hat, davon ein Großteil in den USA, könnte ein erfolgreicher Aufruf zur richtigen Zeit in der richtigen Art und gerichtet an die richtigen Leute, ein politisches Erdbeben erzeugen, so wie sie derzeit auf ihrer Eras-Tour in manchen Stadien bereits kleine Erdbeben erzeugt hat.
Angenommen sie hat in den USA 100 Millionen Follower, dann sind davon der Großteil weiblich und jung. Das ist keine sehr wahlaffine Gruppe, die haben meist andere Dinge im Kopf als sich zwischen zwei alten Männern entscheiden zu müssen. Wenn Taylor Swift es schafft davon nur ein einziges Prozent zur Wahl zu bewegen, könnte das den Ausschlag gegen Trump geben.
Viel politisch wirksamer kann man (frau!) nicht agieren.
h.) Die Querschnittsfrau
Ein Auswuchs des „Taylorverse“ (statt Universe) sind kitschige Liebesromane, die bei Swifties gerade sehr gefragt sind. Zu Beginn dieser Romane gibt es meistens eine Playlist, auf der Taylor mehrfach vertreten ist.
Sie spielt mit diesem Element in ihren Shows und Interviews, wo sie sich absolut nicht als Beziehungsgewinnerin präsentiert, sondern durchaus mit einer komplexen Liebesvergangenheit mit Höhen und Tiefen. Das bringt sie nicht nur ihren Fans näher, sondern ist auch klares Element ihrer Person.
Sie spielt aber noch in viele andere Lebensbereiche hinein. Es ist in Mode gekommen auf einem Swift-Konzert der Freundin den Heiratsantrag zu machen. Und ihre Fans treten miteinander in Interaktion, quasi als Nebeneffekt zum Konzert. Noch klarer wird das bei „Swifties-Nights“, also Veranstaltungen, zu denen Swifties kommen. Dort ist Taylor maximal über Lautsprecher oder eine Videowall präsent, aber das ist egal.
Ihre Fans knüpfen und tauschen Freundschaftsarmbänder, das hat sich zu einem riesigen Hype entwickelt. Der Ursprung ist eine einzige Zeile in einem ihrer Lieder (You´re on your own, kid), wo sie singt „So make the friendship bracelets“ – das war´s, mehr kam da nicht. Aber das hat gereicht.
Das Taylorverse reicht aber noch weiter, wird noch breiter. Sie nimmt die Strömungen, Ideen, Anregungen, Wünsche ihrer Fans und noch vieles mehr auf und rezipiert darauf, baut sie ein, entwickelt sie weiter, verändert sie. Somit arbeitet nicht nur sie am Taylorverse, an der Veränderung dieses kleinen Universums (das Universum ist per se nicht klein, nur so am Rande), sondern alle gemeinsam.
i.) Die Schreiberin
Nicht nur Texte für ihre Lieder, sie schreibt sich Frust von der Seele, sie wird im Schreiben kreativ. Das ist weit entfernt von normalen Pop-Sternchen, denen irgendjemand die Texte und auch den Rest erzeugt. Taylor schreibt Kurzgeschichten und es wäre ein großer Fehler, sie auf eine „Texterin“ zu reduzieren, wie Glasenapp erklärt: Sie ist eine Musikerin, ihre Texte mögen gut sein, aber erst in der Verbindung mit der Musik entfalten sie die Kraft, in der die wahre Taylor Swift steckt.
Die Summe aus all diesen Elementen lässt das Phänomen Taylor Swift erahnen. Wo sie wirklich einzuordnen ist, wird sich gegen Ende 2024 zeigen. Bis dahin bleibt sie auf jeden Fall ein stabiler Faktor in einer Welt, die immer mehr in die Instabilität abgleitet. Allein dafür verdient sie sich durchaus unsere Bewunderung, zumindest aber unseren Respekt.