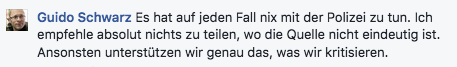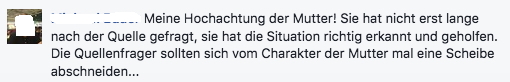Die folgende Geschichte ist leider weder lustig noch erfreulich. Vielleicht kann sie aber den geschätzten LeserInnen dieses Weblogs die eine oder andere Erkenntnis liefern.
Es begann letzten Freitag, am 25. Mai 2018 in der Früh, kurz nach dem Aufstehen. Auf einmal verspürte ich ein Ziehen in der linken Nierengegend, wie ich es noch nie gespürt hatte.
Dann schlug der Blitz ein. Absolut unerwartet und mit voller Härte. Ich hatte solche Schmerzen bisher nur einmal erlebt, nämlich in Form von schwerem Zahnweh.
Und ich hatte keine Ahnung, was das sein könnte. Ich krümmte mich am Boden, einfach hoffend, dass der Schmerz verschwinden würde. Ein brutales Stechen, das sich in den Unterleib ausbreitete, vor allem in die Hodengegend. Ich versuchte eine Stellung zu finden, in der die Schmerzen weniger würden, blieb aber erfolglos. Auch der Kreislauf drohte zusammenzubrechen, ich musste mich auf den Boden legen.
Irgendwann, das Zeitempfinden ist in solchen Fällen gestört, wurden die Schmerzen weniger und hörten fast auf. Ich musste zu einem Termin und konnte nur hoffen, dass sie nicht mehr auftreten würden.
Das war glücklicherweise auch so, beim Termin gab es noch da und dort ein Zwicken, aber es schien überstanden zu sein. Ich hatte immer noch keine Ahnung womit ich es zu tun hatte, aber da es weg war, vergaß ich es – nicht ohne dass eine kleine Sorge zurück blieb. Was mag das wohl gewesen sein? Eine Darmschlinge, die sich verirrt hatte?
Am Abend ging es mir prächtig, ich fuhr zum Heurigen und am nächsten Tag zu einem Vespa-Treffen. Alles war wie immer, bis ich am frühen Abend bei mir auf der Couch saß und auf einmal das Ziehen wieder kam.
Und dann wieder der Blitz. Mindestens genauso brutal wie beim ersten Mal am Tag davor. Eindeutig aus der Nierengegend, linke Seite. Es dauerte diesmal länger und ich dachte, ich müsste verrückt werden. Die Schmerzen waren eigentlich nicht auszuhalten.
Doch es ging auch diesmal vorüber. Nur war mir inzwischen klar, dass ich zu hoch gepokert hatte. Und ich musste ins alte AKH zu einem Festival, 3 Stunden einen Stand betreuen.
Also stieg ich auf den Roller und fuhr hin. Kurz nach der Begrüßung meiner Kollegen ging es dann wieder los. Fast so schlimm wie zuvor, nur dass ich dort kein Bett hatte, auf das ich mich legen konnte. Stehen ging aber nicht, also legte ich mich auf den nackten Asphaltboden und meine Kolleginnen schoben ihre Jacken drunter.
Ich konnte noch immer nicht erklären, was da los war, aber sie holten sicherheitshalber die Rot-Kreuz-Sanitäter, die am Festival sowieso Dienst taten.
Denen schilderte ich die Schmerzen und da kam von irgendwo auch das erste Mal der Begriff „Nierenkolik“ auf. Die Sanis beschlossen mich zu einem Sanitätsraum zu bringen, wo auch eine Notärztin anwesend war. Also wurde ich auf eine Art Rollstuhl geschnallt und durch die neugierige Menge abtransportiert.
Mir war das aber weitgehend egal, die Schmerzen bestimmten mein gesamtes Dasein in diesen Minuten.
Bei der Notärztin angekommen begann die Anamnese. Ein kurzer Schlag auf die linke Niere und der Verdacht erhärtete sich: eine Nierenkolik. Also bekam ich eine Infusion mit Schmerzmitteln und die Sanis riefen die Rettung, die an diesem schönen Abend allerdings noch einige dringendere Fahrten zu erledigen hatten und sich somit verspätete. Das war aber okay, denn die Schmerzmittel wirkten schnell und ich hatte durch einen der sehr netten Sanis eine gute Ansprache – er war AHS-Lehrer für Religion und Ethik.
Irgendwann kam die Rettung und wir fuhren zu meinem Glück ins AKH. Das ist nicht selbstverständlich, denn die Rettungswägen werden dorthin geleitet, wo gerade Platz ist bzw. Dienst getan wird.
Sie nahmen gleich die Abkürzung durch die AKH-Akademie und so waren wir keine zwei Minuten später schon in der Notaufnahme. Dort gibt es eine Erstbegutachtung und da ich mit der Rettung geliefert wurde, kam ich auch gleich dran. Ein Harntest, dann zur Leitstelle (6D), von dort die Info, dass ich vor einem Zimmer auf einem langen Gang warten solle, bis der Urologe käme um sich das anzuschauen.
Das dauerte, denn der Arzt hatte Nachtdienst auf der Station und kam nur auf Anfrage, die leider nicht stattfand, weil – wie er später meinte – er keinen Anruf erhalten hätte. Neben mir saßen noch diverse andere Patientinnen und Patienten, viele davon mit Begleitung, alle mit ganz unterschiedlichen Problemen. Bei mir wirkte noch das Schmerzmittel von der Notärztin und so ging es einigermaßen.
An diesem Ort würden Experten der neuen Datenschutz-Grundverordnung sofort einen Kollaps bekommen – die Namen der PatientInnen werden laut durch die Gänge gebrüllt, so dass jeder, absolut jeder hören kann, dass die Frau Novak oder der Herr Schwarz jetzt in der Urologie dran wären.
Irgendwann war er dann da und ich war sehr erleichtert. Endlich sieht sich jemand mein Problem an, der was davon versteht. Einen kurzen Ultraschall später kam die Diagnose „Nierenstein“ und der Arzt meinte, er würde mich jetzt gleich zum CT schicken, weil er sicher sein wolle. Dazu noch eine Blutabnahme, die er gleich sofort und selbst durchführte. Jetzt ging was weiter.
Das Röhrchen mit dem Harntest hatte er übrigens sofort in den Mülleimer geschmissen. Auf meine Nachfrage bekam ich zur Antwort: „Was soll ich damit anfangen? Wir verwenden hier ein anderes System.“
Das war interessant und erinnerte mich an die Blutabnahme seinerzeit bei meiner Einlieferung wegen des Rollenunfalls. Die war auch verschwunden und ist bis heute nicht wieder aufgetaucht. Krankenhäuser sind schon ein seltsamer Ort.
Die CT ist nur zwei Gänge weiter (das AKH als voll ausgestattetes Krankenhaus hat hier so seine Vorteile) und ich kam auch fast gleich dran, lediglich ein älterer Herr war noch vor mir, aber rein in die Röhre und wieder raus aus der Röhre dauert nicht lang.
Die Röhre selbst ist unspektakulär. Du bekommst erklärt, dass dir eh alles erklärt werde und dann verschwindet der Bediener hinter der Schutztüre. Eine Computerstimme sagt dir, wann du den Atem anhalten sollst und wann nicht. Summend rein, ein paar Mal hin und her – fertig.
Dann wieder zurück und warten. Irgendwann kam der Arzt wieder und meinte, er hätte jetzt auch schon den Blutbefund, der aber unauffällig wäre. Er zeigte mir den Nierenstein am CT und meinte, der wäre ca. 4 mm groß und würde normalerweise durch den Harnleiter in die Blase abgehen und damit wäre der Fall erledigt.
Dazu würde er mir schmerzstillende Medikamente verschreiben plus eines, das den Abgang unterstützen solle. Und ich müsste halt warten und Geduld haben.
Da „patientia“ bei den alten Lateinern die Geduld war, blieb mir als Patient auch nichts anderes übrig und ich fuhr zur Nachtapotheke. Die nahm mir zwar gepflegte 23 Euro ab, das war aber mein geringstes Problem.
Die Nacht war aushaltbar, der Sonntag dann so lala. Ich schluckte brav meine Medikamente und hoffte, dass der Stein abgehen würde. Im Internet war zu lesen, dass Bewegung und auch Treppen hüpfen helfen würde, den Stein los zu werden. Also hüpfte ich die Treppen in meinem Stiegenhaus hinunter und auch in meiner Wohnung herum. Viel trinken sollte ich auch. Allerdings hat das den Nachteil, dass die Niere mehr arbeiten muss und die Harnleiter dann ihre Kontraktionen erhöhen. Das treibt zwar den Nierenstein hinaus (wenn er sich hinaustreiben lässt, bewirkt aber die mir inzwischen bekannten höllischen Schmerzen.
Sie bewirkten wiederum dass ich keinen Hunger hatte. Am Abend war ich bei einer Kollegin zum Essen eingeladen, wusste aber nicht, ob ich das ohne neue Kolik schaffen würde. Die Vorstellung, am Motorroller von diesen Schmerzen überrascht zu werden, von denen ich nie wusste, wann sie kommen würden, war weniger erbaulich.
Irgendwann fuhr ich aber hin (es sind nur wenige Minuten) und konnte auch was essen – wenngleich nur vergleichsweise wenig.
In der Nacht kamen die Schmerzen wieder und ich begann langsam Angst davor zu bekommen. Ängste sind ja nie angenehm, aber die Angst vor unerwartetem Schmerz ist eine besonders unangenehme.
Besonders schlimm ist es in der Früh, wenn die Niere zu arbeiten anfängt. Dummerweise hatte ich am Montag mehrere wichtige Termine. Den ersten konnte ich verschieben, der zweite bestand aus zwei schwierigen und langen Interviews bei einem Kunden. Ich wollte sie nicht verschieben, hatte aber um fünf Uhr morgens wieder eine so starke Kolik, dass ich keinen Ausweg mehr wusste als wieder ins AKH zu fahren.
Um 07:30 machte ich mich auf den Weg und wusste, dass ich gleich zur Urologie-Ambulanz gehen konnte. Die befindet sich auf 8D und hat die schon bekannte Leitstelle.
Dummerweise war ich nicht der einzige, die Sesselreihen im Wartebereich waren schon halbvoll. Ich konnte mir ausrechnen, wie lange ich hier warten müsste und wusste: das stehe ich nicht durch!
Also griff ich zu einem Trick, der zwar alt, aber bewährt ist. Und ich musste genau genommen gar nicht schummeln, denn ich hatte ja Schmerzen und es ging mir tatsächlich nicht sehr gut.
Also durfte ich mich auf ein bereit stehendes Bett legen und dann warten, bis die Ärzte aus der Morgenbesprechung kamen.
Das dauerte nicht lange und ich wurde aufgerufen. Ein junger Arzt begleitete mich in sein Behandlungszimmer und hörte sich meine Geschichte an.
Eine Ultraschall-Untersuchung zeigte: Stark gestaute Niere. Der Stein war definitiv noch nicht weg. Okay, das hätte ich auch so gewusst.
Trotzdem meinte der Arzt, er würde gerne noch bei der konservativen Therapie bleiben. Leider könne man nicht sagen, wie weit sich der Stein schon fortbewegt hätte, denn es gäbe keine Möglichkeit das im Ultraschall zu sehen und noch ein CT wolle er mir wegen der Strahlenbelastung nicht antun.
Das mit der Strahlenbelastung erschien mir komisch, ich war aber nicht kräftig genug um Widerstand zu leisten und wollte den Stein ja auch durch natürlichen Abgang loswerden.
Er würde mir die Novalgin-Tabletten in einer großen Packung verschreiben, ich müsse dazu aber ein paar Minuten warten, weil sie chefarztpflichtig wären.
Also warten. Glücklicherweise dauerte es nur ca. 30 Minuten, dann bekam ich mein Rezept und ging wieder, da und dort hüpfend und mit sehr gemischten Gefühlen.
Das erste Interview konnte ich machen, wenngleich ich es auch nach einer guten Stunde abbrechen musste. Das zweite ging gar nicht mehr, ich musste nach Hause fahren um mich auszuruhen. Auch zum Abendtermin musste ich mich entschuldigen.
Das Gemeine ist das Auf und Ab. Manchmal war ich fast schmerzfrei und dachte mir: Hurra, der Stein hat den Harnleiter durchwandert, ist in der Blase angekommen und wartet jetzt nur darauf ausgespült zu werden. Ich pinkelte ja schon seit dem Krankenhaus brav durch ein Sieb, bisher war aber noch kein Stein erschienen.
Das blieb leider auch den ganzen Montag so und machte mir einigermaßen zu schaffen. Es tauchen ständig Fragen und Phantasien auf, die ins Leere gehen: Ist der Stein vielleicht doch zu dick, obwohl der Arzt gesagt hatte, dass er mit 3 mm oder 4 mm durchpassen müsste?
Was ist, wenn die Koliken öfter kommen? Und wenn sie stärker werden? Kann da sonst noch was passieren? Die grauenvolle Vorstellung einer überstauten und platzenden Niere kommt einem nur in solchen Situationen.
Die Hauptfrage war und blieb aber: Wann kommt der blöde Stein raus? und wo befindet er sich schon? Ich war am Vortag eine Runde im Türkenschanzpark spazieren gegangen, das hatte nichts geholfen. Jetzt hüpfte ich wieder herum und hoffte ständig auf den entscheidenden Ruck. Der kam aber nicht und ich aß die Reste vom Vorabend, die ich von meiner Kollegin mitbekommen hatte.
Die Nacht war wieder mittelprächtig. Da die Niere in der Nacht auch ruht konnte ich einigermaßen gut schlafen. Am Dienstag Vormittag ging ich noch einmal eine Runde in den Türkenschanzpark, was aber ebenfalls nichts bewirkte.
Zu Mittag hatte ich einen wichtigen Akquisitionstermin für ein neues Projekt gemeinsam mit meiner Kollegin Susanne. Den konnte ich einigermaßen würdevoll absolvieren und danach sogar noch nach Traiskirchen fahren, um die neue Kurbelwelle für die Crank-E-Vespa abdrehen zu lassen. Die Schmerzen hielten sich in Grenzen, waren aber immer da. Und ich wusste natürlich nicht, wie stark sie ohne die Tabletten wären. Das ist auch ein beunruhigender Faktor.
Am Abend wurde es schlimmer und bei mir setzte langsam eine gewisse Verzweiflung ein. Wie lang könnte das noch dauern? Wo ist dieser verdammte Stein und wann geht er endlich ab? Bei jedem Mal pinkeln die Hoffnung, bei jedem Mal die Enttäuschung und die Gewissheit, dass die nächste Kolik wohl nicht mehr fern wäre.
Auch die Qualität der Koliken veränderte sich – sie wurden stärker, wenngleich ich mich psychisch schon darauf einstellen konnte, wenn das Ziehen begann. Dafür hielten sie länger an – was zu Beginn noch in 20 Minuten erledigt war, dauerte jetzt zwei Stunden. Das begann mich langsam aber sicher zu zermürben.
Mittwoch Mittag war es dann soweit. Ich hielt die Schmerzen einfach nicht mehr aus und fuhr ins AKH. Ich lebe in der komfortablen Situation das größte Spital Österreichs quasi vor der Haustüre zu haben. Die beiden riesigen Türme des größten Skandalbaus der 1970er sind allgegenwärtig, weshalb mein Großvater schon meinte: Die beiden Türme sind der schönste Ort in ganz Wien, denn nur von dort sieht man die beiden Türme nicht.
Das war mir aber heute herzlich egal, ich brauchte Hilfe. Auf der Notfall-Ambulanz wollte man mich aber nicht zum Urologen lassen, sondern schickte mich eine Schleife zur Erstbegutachtung. Dort hieß es warten, lange warten. In einer Schlange stehend warten – wobei ich nicht wusste, wie lange ich es aushalten würde.
Rettungen kamen und gingen, brachten Patientinnen und Patienten, die (mein alter Trick) sofort dran kamen. Ich erinnerte mich an die Patientia und konnte mich durch die ältere Frau ablenken lassen, die im Rollstuhl saß und sich lautstark beschwerte, dass sie entführt worden sei. Die Rettung habe sie entführt, sie wollte eigentlich auf die Baumgartner Höhe, aber die Rettung hätte sie gegen ihren Willen ins AKH geführt.
Man ging mir ihr genauso routiniert um wie mit allen Patienten. Dann war ich endlich an der Reihe, – Fieber messen, Blutdruck und wieder ein Harntest.
Dieser konnte aber nicht ordentlich ausgewertet werden, weil die Maschine streikte. Also meinte die Ärztin zur Pflegerin, sie solle „manuell auswerten“, was sich aber zu einem mittleren Missverständnisdrama entwickelte. („Leuko negativ, bei 4“ – „Was, Leuko?“ „Nein, das dritte da…“ usw.)
Mir war das herzlich egal, ich wusste eh, was und wohin ich wollte. Dann also zur Anmeldung, wieder eine grüne Mappe ausfassen (man hätte die andere weiterverwenden können, sie war noch wie neu und ich hatte sie ja dabei), wieder warten vor dem Raum „G“.
Dann kam der junge Arzt von Montag Morgen wieder. Das war für mich erfreulich, weil er mich schon kannte und wir gleich zur Sache kamen. Ich dachte, man könnte jetzt mit einem neuen CT zumindest Klarheit schaffen, ob der Stein kurz vor dem Abgang ist oder nicht. Doch das wurde abgelehnt, jetzt müsse eine Schiene gelegt werden – kein großer Eingriff. Man würde mich stationär aufnehmen und ich bekäme die Schiene noch am gleichen Tag und könnte am nächsten Tag wieder heim gehen.
Der Stein müsste dann allerdings bei einem weiteren Termin ein paar Tage später herausoperiert werden, wenn er nicht zufällig dazwischen abgehen würde. Aber die Nierenstauung wäre beseitigt.
Mir erschien das zwar okay, aber ich erlaubte mir sicherheitshalber noch nach einer Alternative zu fragen. Der Arzt dachte nach und meinte dann, doch, es gäbe vielleicht noch eine andere Möglichkeit. Sie würden gerade eine Studie machen über Schiene ja oder nein nach einer Steinentfernung. In diese Studie könnte er mich eventuell aufnehmen, aber das würde davon abhängen, was die Anästhesisten sagen, die nur auf Notfallbetrieb eingestellt wären. Er käme später auf der Station zu mir und würde mir das sagen.
Das waren grundsätzlich einmal keine schlechten Nachrichten: Auf jeden Fall weniger Schmerzen, vielleicht sogar eine größere Lösung.
Also wanderte ich zur Urologiestation auf 17C, jetzt schon wieder mit wirklich starken Schmerzen.
Die Schwester machte die Aufnahme und ich kam in ein Zimmer. Dort gab es dann das ersehnte Fläschchen mit Schmerzinfusion und die Schwester versprach mir, dass die Schmerzen in 15 Minuten vorbei wären.
Das war eine Perspektive, mit der ich gut leben konnte. Glücklicherweise hatte ich außer einem winzigen Stück Striezel in der Früh nichts gegessen und auch nur wenig getrunken (aus Angst vor zu starken Koliken). Eine Operation wäre also möglich.
Ich bekam dann noch einen riesigen Tropf, damit der Durst nicht zu groß werden sollte, dem ich geduldig beim Tropfen zusah.
In dem Zimmer lag noch ein alter Inder mit Turban und langem, weißem Bart samt Frau, Tochter und Enkelin, die alle irgendwie gleich aussahen, nur unterschiedlich alt.
Und ein älterer Herr, der eine Prostataoperation aufgrund von Krebs gerade hinter sich hatte. Sie war allerdings schon so lange vorbei, dass er sehr energiegeladen mit seiner Frau und seiner Tochter streiten konnte, und zwar laut und ohne Pause. Es war eine Unterhaltung, die ich nicht wiedergeben kann und will. Dann kam noch der Sohn, der ebenfalls Arzt sein dürfte und man unterhielt sich gemeinsam über die Professoren und wer gut und wer schlecht wäre und über noch sehr vieles andere. Die Inder verstand ich wenigstens nicht, das war ein Segen.
Es dauerte eine Zeit, aber dann kam der junge Arzt und meinte, die Chancen für die große Lösung ständen gut, ich müsste nur mehr hier und hier und hier und hier unterschreiben und dann könnte ich heute noch operiert werden. Wann genau könne er mir nicht sagen, das hinge von den Anästhesisten ab und wann sie einen Slot für unsere Geschichte hätten.
Ich war definitiv erfreut, sehr erfreut sogar. Vom sehr netten Nachtpfleger (es war inzwischen ca 21 Uhr) bekam ich ein Operationshemd (hinten offen) und die Nachricht, dass es jetzt irgendwann losgehen würde.
Diese jetzt irgendwann kam keine Minute später. Ein Pfleger kam („i bin des Taxi“) und nahm mich mit. Meine Stimmung war ob der Aussicht auf baldige endgültige Schmerzfreiheit exzellent.
Wir fuhren durch die Gänge in den Vorbereitungsraum, wo eine sehr nette OP-Schwester auf mich wartete. Ich erklärte, dass ich mit absolut allem einverstanden wäre, was sie von mir wolle.
Es musste noch entschieden werden, ob die Anästhesistin bei einer Geburt dabei sein würde oder ob ich gleich dran wäre, der Arzt schätzte die Dauer meiner Operation auf eine halbe Stunde und schon ging es los.
Auf die Frage, ob ich eine Vollnarkose bekäme, grinste der Arzt und meinte: ja, das würde ich mir bewusst nicht anschauen wollen.
Der Aufwachraum. Ich kannte so etwas schon von meiner Siebbeinhöhlen-Operation. Es ist ein komisches Gefühl, aber ich war irgendwie bester Laune und als ein Pfleger einen Sack mit Eiswürfeln brachte (um wen oder was auch immer zu kühlen), orderte ich ein Gin Tonic.
Das bekam ich zwar nicht, aber die Stimmung im Aufwachraum war okay.
Irgendwie bekam ich noch mit, dass die Operation offenbar gut verlaufen war. Das ist übrigens eine irre Sache – sie fahren mit einem Endoskop durch die Harnröhre in die Harnblase und von dort weiter in den Harnleiter. Auf diesem Endoskop befinden sich neben der Kamera und einer Lampe noch ein Greifarm, um den Stein packen zu können und eine Laserkanone, um ihn zu zertrümmern. Und das alles passt da durch – mir eigentlich unbegreiflich.
Ich bin der Schulmedizin in vielen Dingen durchaus kritisch gegenüber eingestellt, aber in ebenso vielen Dingen wissen die schon, was sie tun und können es auch sehr gut. Auch der Stand der Technik ist bewundernswert. Ich stelle mir vor mit dem Nierenstein bei einem Schamanen in Behandlung zu sein und es kommt mir absurd vor. Wobei ich nichts gegen Schamanismus habe – letztlich hat alles seine Berechtigung, aber auch seine Grenzen.
In der Früh ging es mir dann plötzlich gar nicht gut. Ich hatte zwar keine Koliken mehr, aber starken Harndrang. Doch das war es nicht. Ich brauchte eine Zeit um drauf zu kommen, was mein Problem war. Mir ging es irgendwie hundeelend und ich wusste nicht warum. Ich war sehr schwach, der Kreislauf ließ noch nicht zu, dass ich aufstand und als ich auf´s Klo ging, konnte ich einen Zusammenbruch gerade noch vermeiden. Das war zwar scheußlich, aber noch keine Erklärung für meinen Zustand.
Dann entdeckte ich, dass mein Problem psychischer Natur war. Ich hatte plötzlich keinen Halt, irgendwie nur negative Gedanken, die sich ineinander verwoben, um sich drehten, wuchsen, intensiver wurden. Es war keine Angst, keine Panik, aber ein Unwohlsein an der Grenze des Erträglichen.
Ich wusste, dass ich positive Gedanken bräuchte – konnte sie aber nicht fassen. Zukünftige Vespa-Touren durch sonnendurchflutete Landschaften – funktionierte nicht. Fast am schlimmsten war, dass ich keine Ahnung hatte, was da los war.
Dann kam der Arzt, der mich operiert hatte. Er brachte die gute Nachricht, dass die Operation gut verlaufen wäre und man den Stein zertrümmern hätte können. Danach wurden die Fragmente entfernt und ich bekam die Schiene in den Harnleiter (übrigens 26 cm lang). In die Studie wurde ich nicht aufgenommen, da bei den Verletzungen meines sehr engen Harnleiters diese sowieso obligat gewesen wäre.
Und es war klar: Der Stein wäre von alleine nie und nimmer abgegangen – er war zu groß für meinen Harnleiter und steckte immer noch dort, wo er fünf Tage zuvor diagnostiziert worden war.
All das Hüpfen und Hoffen waren umsonst gewesen – aber wer hätte das wissen können?
Ich würde wohl noch einige Tage Blut im Urin haben und die Schiene könnte zwicken – aber sonst sollte ab jetzt alles okay sein, meinte er. Und ich könnte heute noch nach Hause gehen oder aber noch eine Nacht da bleiben – sie hätten gerade genügend Betten und das wäre kein Problem.
Meine Stimmung besserte sich, ich vergaß aber leider noch einige wichtige Fragen zu stellen – was ich später bereuen sollte.
Auch bei der Visite, die durch einen mir unbekannten Oberarzt durchgeführt wurde, hatte ich die richtigen Fragen nicht parat – etwa woher die Koliken kommen könnten, die der Oberarzt als mögliche Nachwirkungen erwähnte. Er meinte aber auch, dass all die Schmerzen, die jetzt kommen würden, kein Vergleich mit dem wären, was ich durchgemacht hätte. Das war beruhigend.
Ich blieb noch einige Stunden, genau genommen bis zum Mittagessen, von dem ich aber nur ein paar Bissen runterbrachte. Immerhin, ein wenig Appetit kam langsam zurück, ich hatte in der Früh nur die Banane gegessen und fühlte mich insgesamt noch sehr schwach.
Dann war es Zeit zu gehen. Dummerweise war die Schwester grad so beschäftigt, dass sie mir keine Entlassungspapiere vorbereiten konnte. Auch die Ärztin, von der noch Papiere fehlten, war gerade nicht verfügbar.
Also ging ich so – aus ärztlicher Sicht war ich ja (mündlich) entlassen worden. Mit etwas wackeligen Beinen, aber ohne Schmerzen. Dafür mit dem Gefühl als müsste ich ständig pinkeln. Die Papiere, so meinte die Schwester, könnte ich irgendwann abholen, da ging es vor allem um den Patientenbrief für den Urologen, der mir in zwei Wochen die Schiene entfernen sollte.
Es war ein traumhafter Tag und ich war fertig. Der Heimweg hatte viel Kraft gekostet und wahrscheinlich hatte ich auch noch Nachwirkungen von der Narkose.
In der Nacht von Donnerstag auf Freitag konnte ich ganz gut schlafen und hatte einiges aufzuholen. Auf jeden Fall jedoch eine wichtige Projektbesprechung, zu der ich in den dritten Bezirk fahren musste. Das klappte aber, wenngleich ich mich bei der Besprechung sehr konzentrieren musste.
Aber der Appetit kam wieder und mit dem Essen auch die Kraft. Die Schiene drückte, Harnlassen schmerzte und auch ganz generell fühlte ich mich alles andere als gesund und war froh, als ich wieder daheim war.
Dann kam ein leichtes Ziehen links hinten. Nur ganz leicht, aber das löste sofort ein deutlich spürbares Angstgefühl aus. Angst vor den Schmerzen, die ich schon kannte. Wobei – ein wenig Ziehen macht noch nichts.
Doch das Ziehen wurde stärker und stärker. Ich musste mich wieder ins Bett legen, doch auch da wurden die Schmerzen wieder stärker. Zu meiner riesigen Enttäuschung wurde klar: Das ist der alte Schmerz, das ist die linke Niere, das ist der totale Frust. Meine Stimmung entwickelte sich zu einer Mischung aus Ärger auf alles, Enttäuschung, Frust, Hilflosigkeit und ein Rest von Hoffnung, dass das irgendwie schnell vorbeigehen würde.
Es ging nicht vorbei, ganz im Gegenteil. Die Schmerzen wurden stärker und stärker, ich schluckte zwei Novalgin (eigentlich hatte ich gehofft ohne Schmerzmittel über die Runden zu kommen) und nahm später noch Novalgin-Tropfen.
Doch es nutzte nichts. Die Schmerzen wurden mehr und mehr, nicht ganz so stechend wie der Blitz, der vor der Operation immer wieder eingeschlagen hatte, aber in Summe nicht viel leichter. Und vor allem gingen sie nicht mehr weg, sondern nahmen kontinuierlich zu, so wie meine Angst, dass es von vorne losgehen würde.
Ich erinnerte mich an die Worte des Arztes bei der Visite, dass Koliken durchaus noch möglich wären und ärgerte mich, dass ich ihn nicht gefragt hatte, woher die kommen würden. Das freundliche Nicken auf meine Frage, ob die Schmerzen eh lange nicht so stark sein würden wie vor der Operation, erschien mir jetzt wie blanker Hohn.
Ganz besonders schlimm war die Ungewissheit nicht zu wissen, wo die Schmerzen herkamen. Der Stein war doch draußen – was veranlasste den Harnleiter zu diesen schmerzhaften Kontraktionen? Und wieso waren die so stark, wenn sie doch nur leichte Nachwehen hätten sein sollen?
Und vor allem: Was kann ich jetzt tun? Die Schmerzen waren eigentlich nicht aashaltbar, vor allem, weil die Schmerzmittel gefühltermaßen überhaupt nicht (mehr) ansprachen.
Bei einem kurzen Telefonat empfahl mir Susanne doch den Ärztefunkdienst anzurufen und um Rat zu fragen. Ich hatte sonst ja nur mehr die Option mich mit der Rettung wieder ins AKH bringen zu lassen – keine angenehme Vorstellung: wieder die gleiche Prozedur, wieder das Warten – ich hatte einfach keine Lust.
Die nette Ärztin vom Ärztefunkdienst war jedoch ein Lichtblick. Sie meinte, es könnte sein, dass ein kleiner Rest des Nierensteins noch irgendwo steckte und diese Schmerzen – ja, auch starke Schmerzen – verursachte.
Allein diese Erklärung half mir schon und auch die Tatsache, dass mir jemand zuhörte, der kompetent war. Sie meinte, dass sie mir einen Kollegen vorbei schicken könnte, der mir ein stärkeres Schmerzmittel geben könnte und ob ich es noch so lange aushalten würde, denn die Wartezeit würde etwa eine Stunde betragen.
Ich antwortete ihr, dass das völlig in Ordnung wäre und dass es mir ohnehin unangenehm sei, einen Arzt von vielleicht wichtigeren Einsätzen abzuhalten.
Ihre Reaktion war deutlich: „Wir wissen, wie Nierenkoliken sind. Da wird der leichte Schnupfen von jemand anderem halt warten müssen.“
Also wartete ich und beschloss, in der Zwischenzeit eine Dusche zu nehmen. Als ich gerade das Wasser aufdrehte, läutete es an der Türe. Es war bereits der Notarzt, der mich auch sofort untersuchte: Bauch abtasten, schauen, wo es schmerzt – Ergebnis: Bauch weich, Schmerzen wahrscheinlich von einem Nierensteinrest – gleiche Diagnose wie von der Ärztin am Telefon.
Der Arzt empfahl mir eine Novalgin-Spritze intramuskulär – hinein in den Hintern und nach ca. 45 Minuten würde dann die volle Wirkung einsetzen. Das wäre insofern gut, weil ich dann beim gleichen Schmerzmittel bleiben könnte.
Also hinein mit dem Jauckerl! Und dann warten. Lange warten, denn nach 45 Minuten geschah leider erst einmal gar nichts und meine Verzweiflung nahm langsam wieder zu. Was, wenn das Mittel nicht wirkt? Und was ist mit dem Nierensteines – geht der diesmal von alleine ab?
Es dauerte 75 Minuten, dann aber setzte die Wirkung fast schlagartig ein und die Schmerzen ließen deutlich nach, gingen fast ganz weg. Unterstützend wirkte, dass ich mich langsam entspannte, als die Schmerzen weniger wurden, auch durch die Gewissheit, dass zumindest das Mittel jetzt wirken würde.
Als ich etwas später pinkeln ging, sah ich auf einmal ein kleines, schwarzes Ding in der Muschel, das aber wenige Sekunden später hinunter rutschte, noch bevor ich es bergen konnte.
Meine Hoffnung war, dass dies das letzte Reststück vom Nierenstein war, das bei der Operation übersehen wurde. Da gebe ich die Schuld nicht dem Operateur, denn es war irgendwie einleuchtend, dass in diesem geschwollenen Harnleiterchaos mit der kleinen Endoskopkamera keine Garantie inkludiert sein konnte, dass alle Teile restlos entfernt werden konnten.
Hoffentlich war es das. Hoffentlich. Ein bisschen Glück hätte ich jetzt verdient.
Also die Nacht abwarten. Glücklicherweise ohne Schmerzen, nur mit starken Schweißausbrüchen, die aber als Nebenwirkung von der Spritze angekündigt waren und kein Problem darstellten.
Nach einer durchschwitzten Nacht wachte ich Samstag früh schmerzfrei auf. Das Gefühl in der Nierengegend war gut, es war keinerlei Ziehen mehr da, wobei ich natürlich nicht wusste, wie das ohne Schmerzmittel aussehen würde und auch nicht, ob und wie stark die Spritze noch wirkte.
Zur Sicherheit beschloss ich noch ein oder zwei Novalgin einzuwerfen, denn ich hatte einfach überhaupt keine Lust auf neue Schmerzen, auch nicht auf schwache.
Doch es kamen keine Schmerzen, und zwar auch nicht, als ich zu Mittag keine weiteren Tabletten mehr nahm. Und auch nicht am Nachmittag oder am Abend. Nur das unangenehme Gefühl des dauernden Harndrangs, das ich darauf zurück führte, dass die Schiene (ein 26 cm langer Plastikschlauch) in der Harnblase Druck verursachte, was diese als Harndrangsgefühl weiterleitete.
Das war unangenehm, aber auszuhalten. Der Urin entsprach farblich in etwa einem gepflegten Rotwein, das war jedoch normal, wie der Arzt mir versichert hatte.
So überstand ich den Samstag und die Chancen stiegen, dass die Nierensteingeschichte jetzt überwunden war. Ich beschloss noch auf den Sonntag zu warten, der jedoch auch ohne neue Schmerzen ablief. Alles inzwischen ohne Schmerzmittel und somit quasi „real“.
Meine Lebensgeister kamen langsam zurück, denn jeder neue Tag vergrößerte die Chance, dass es überstanden war. Der Blasendruck war und blieb unangenehm, der Urin wurde langsam gelb, dann wieder rötlicher, dann wieder gelb, wieder rötlicher – wahrscheinlich eine normale Entwicklung. Ich würde das den Urologen fragen, mit dem ich mir ja einen Termin für die Schienenentfernung ausmachen musste.
In der Ordination wurde mir bestätigt, dass der Urologe die Schiene ambulant entfernen könnte, einen Termin gäbe es aber erst wieder Mitte August.
Auf meine Frage, was ich denn dann tun könnte, antwortete die nette Sprechstundenhilfe, dass ich einfach zur Ordinationszeit vorbei kommen könnte, aber es würde halt eher lange dauern und ich sollte eine Menge Geduld mitbringen.
Mein Gedanke: Wenn schon vorher eine ewige Wartezeit angekündigt wird – wie sieht das dann in der Praxis aus?
Glücklicherweise fiel mir bei meiner Internetrecherche der Jörg auf, ein alter Bekannter, bei dem ich vergessen hatte, dass er ja Urologe ist. Ich hatte beim Aufbau der Vespa seines Sohnes mitgeholfen und irgendwie war es da dann doch leichter einen echten Termin zu bekommen.
Jörg empfahl mir die zwei Wochen auf jeden Fall abzuwarten, damit der Harnleiter ordentlich ausheilen könnte. Sehr angenehm war diese Vorstellung nicht, aber der Gedanke, dass es danach zu Komplikationen kommen könnte, war noch weniger erfrischend.
Die nächsten Tage würde ich als mittelprächtig beschreiben. Nierenschmerzen gab es keine mehr, doch der ständige Blasendruck war nervig. Dazu kam die weiterhin wechselnde Urinfarbe, die ebenfalls demotivierend wirkte: Jöö, kein Blut mehr… und dann, meist am Abend: alles wieder rot.
Was wirklich half: Bier trinken. Vielleicht nur wegen der vermehrten Flüssigkeitsaufnahme und der beruhigenden Wirkung des Alkohols, aber das war mir herzlich egal – es wirkte.
So vergingen die Tage ohne nennenswerte Veränderung bis zum Dienstag, den 12. Juni. Ich fuhr mit dem Roller nach Baden, wo es nach nicht einmal fünf Minuten Wartezeit zur Sache ging: Hose runter, auf eine Liege legen und schon kam Jörg samt Assistentin mit einem seltsamen Gerät. Sein Versprechen das möglichst sanft zu versuchen klang durchaus glaubwürdig und ich war mir außerdem sicher, dass die Schmerzen im Vergleich zu dem, was ich durchgemacht hatte, maximal Kinderfaschingsqualitäten haben würden und zudem noch sehr kurz andauern sollten.
„Jetzt muss ich an der Prostata vorbei“ klang weniger verlockend, aber auch das war aushaltbar. Vor allem, weil keine zwei Minuten später die Schiene heraußen war – ein dünner Plastikschlauch mit eingekringelten Enden. Mir ist nach wie vor schleierhaft, wie das alles durch die Harnröhre passt, aber es ist nun einmal so.
Hose anziehen, mit herzlichem Dank verabschieden und schon ging es (nach einem kurzen Besuch am WC) wieder ab nach Hause. Das Brennen würde nicht lange anhalten, meinte Jörg, ein wenig Blut im Urin als Nachwirkung könnte es schon geben. Und ich hätte ja sicher noch Schmerzmittel daheim.
Mein Ehrgeiz war erwacht und ich wollte versuchen ohne Schmerzmittel die Nachwirkungen zu überstehen. Der Blasendruck war leider immer noch da und am späten Nachmittag kam auch noch ein leichtes Ziehen in der linken Nierengegend dazu. Ich kannte dieses Ziehen nur allzu gut, als aber Jörg am Abend noch einmal anrief, konnte er mich beruhigen: Da könnte nichts passieren, ein Nierenstau wäre auszuschließen und ich solle noch die Nacht abwarten.
Am nächsten Morgen war das Gefühl gut – keine Schmerzen, ein sehr leichtes Brennen und klarer Urin. Wenn das so bleibt – alles bestens.
Fazit: Auch einige Tage später blieb alles im grünen Bereich und es sieht so aus, als wäre die Sache endgültig überstanden. Ich hoffe, dass ich zu den 50% der Menschen gehöre, die keine weiteren Nierensteine mehr bekommt, denn diese Tortur möchte ich nicht noch einmal durchmachen. Echt nicht. Und ich wünsche sie auch niemandem, nicht einmal meinem schlimmsten Feind.