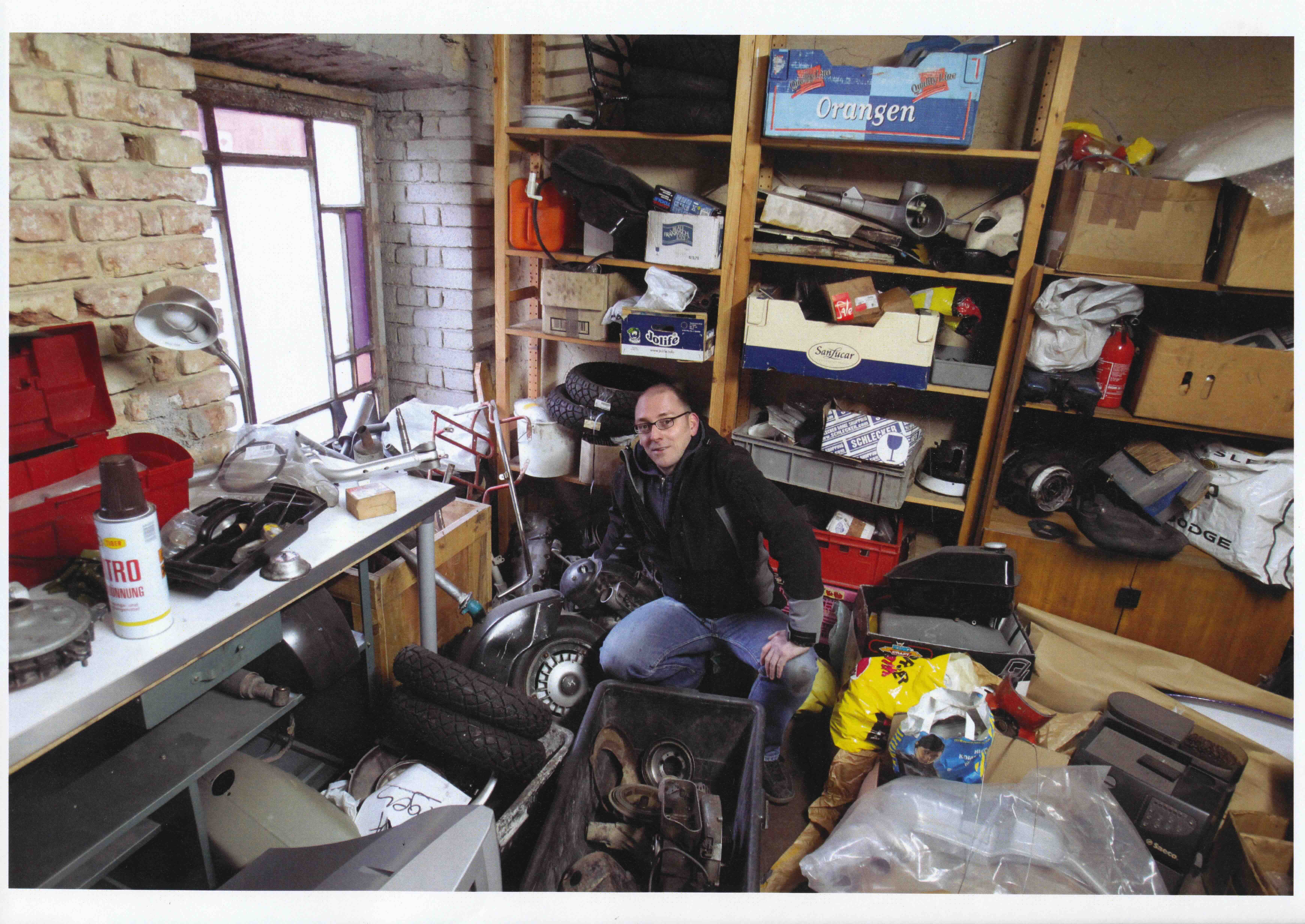Wer kennt noch Vance Packard?
Er hat das berühmte Buch „Die geheimen Verführer“ geschrieben und das ist jetzt schon lange her. 1971 wurde „Der Griff nach dem Unbewußten in Jedermann“ (so der Untertitel) bereits mit anschaulichen Beispielen beschrieben.
Nach mehr als einem halben Jahrhundert haben die Marketingstrategen deutlich dazugelernt und es gibt neben den alten Tricks – die immer noch funktionieren – jede Menge neue.
Und die Konsumentinnen und Konsumenten spielen brav mit, manchmal wirkt es sogar, als wollten sie getäuscht werden.
Dabei ist deutlich zwischen dem Magier im Zirkus und dem Supermarkt zu unterscheiden. Nehmen wir gleich ein aktuelles Beispiel.
In Österreich ist der Lebensmittelhandel in den Händen von drei großen Anbietern: SPAR, REWE und ALDI (der bei uns HOFER heißt).
Der Rest spielt eine untergeordnete Rolle.
Neulich bei SPAR

Bild: Preiselbeerstapel bei SPAR
Ich sehe einen großen Stapel Preiselbeerkompott, beworben wird die Köstlichkeit auf einem Schild mit dem rot unterlegten Spruch „JETZT ZUGREIFEN!“ (in Blockbuchstaben). Die Menge beträgt 600g und kostet 5,99 Euro.
Vor ein paar Jahren wurden die Supermarktketten dazu gezwungen, bei bestimmten Produkten den Kilopreis dazuzuschreiben, in diesem Fall wurde das so winzig gedruckt, dass man es nur mit sehr guten Augen lesen kann: (= per kg 9,98)
Gleich daneben steht ein anderer Stapel, ebenfalls Wildpreiselbeeren der gleichen Marke (d´arbo) in einem etwas kleineren Glas (450g).
Auf diesem Stapel hängt leider kein Preisschild, aber im Regal lässt sich das dann finden: Diese Preiselbeeren sind in Aktion und kosten statt 3,99 nur 3,29 Euro. Hier ist der Kilopreis deutlicher lesbar. 7,31 per kg.

Bild: Der Preiselbeerstapel 1x ums Eck bei SPAR
Selbst mit dem ursprünglichen Preis von knapp 4 Euro ist das noch deutlich günstiger als das 600g-Glas.
Die Täuschung entsteht durch die Aufmachung als Sonderangebot, obwohl es keines ist – ganz im Gegenteil. Der Vorteil liegt ausschließlich auf Seiten des Handels, der Nachteil ganz bei der Kundschaft, außer man sucht genau nach so einer Glasform und will dafür gerne mehr bezahlen.
Täuschung passiert auf vielen Ebenen. Die größte ist wohl das Glücksversprechen der Konsumindustrie.
Das baut auf einem wahren Kern auf: Wir alle sind bedürftige Wesen, von Natur aus sozusagen. Wir müssen konsumieren, sonst sterben wir.
Die Frage ist nur: Was und wie viel?
Der Kabarettist Christoph Sieber hat das sehr gut in einem seiner Auftritte zusammengefasst: Unser Gehirn hat die moderne Welt noch nicht mitbekommen, es lebt quasi in der Vergangenheit der letzten 100.000 Jahre oder noch länger zurück: Wenn der Neandertaler an einem Strauch mit Beeren vorbeigekommen ist, dann hat ihm sein Gehirn gesagt: Iss sie alle, das ist Zucker, das ist Energie, die brauchen wir, iss so viel wie möglich, denn vielleicht gibt es jetzt länger keine mehr.
Unser Gehirn sagt das heute noch, es kennt keine Überflusswelt. Das Ergebnis kennen wir: Zu viel Zucker, zu viel Kalorien, der Körper wird fett, weil das Gehirn das nicht steuern kann.
Als historisches Mangelwesen nehmen wir, was wir bekommen können. Ein „zu viel“ gibt es für unser Gehirn nicht.
Auch wenn diese Darstellung etwas verkürzt sein mag, das Ergebnis ist überall sichtbar. Die Konsumindustrie lebt nun davon, dass wir keine natürlichen, instinktgesteuerten Grenzen kennen. Um von den Beeren möglichst viel essen zu können, gibt es die Gier. Sie enthemmt die Begrenzung, vor allem die soziale: Wenn wir etwas sehen, das uns gefällt, wollen wir es haben, und zwar möglichst viel davon, am besten alles. Unser Sozialverhalten hält dagegen: Lass den anderen auch was, teile es mit Menschen, die du magst und mit denen du in einem Sozialverband lebst.
Die Gier sagt: Nimm dir alles, wenn es morgen nichts mehr gibt, dann überlebst wenigstens du. Kümmere dich vor allem um dich selbst. Modern gesprochen ist das der „Self-made-man“, der uns als Ideal angepriesen wird: Er kümmert sich um sich und seine Karriere, er strebt nach grenzenlosem Erfolg, er ist möglichst unabhängig, im Idealfall komplett. Das Bild dazu ist die „Leck-mich-Million“ – das ist der Betrag, der es uns ermöglicht zu allen Menschen jederzeit „leck mich“ sagen zu können. Den Begriff kenne ich aus dem Roman „Noble House“ von James Clavell. Dort ist er das Leitmotiv einer jungen, attraktiven Frau, die als Lebensziel nicht nur das Verdienen von möglichst viel Geld hat, sondern ein Leben ohne räumliche Bindung. Sie zieht von Hotel zu Hotel, von Land zu Land, mit nicht viel mehr als ihrer Kreditkarte, mit der überall auf der Welt unbeschränkt Geld zu bekommen ist.
Hier erkennen wir auch den darin enthaltenen Freiheitsbegriff: Unabhängig von Raum (einem Ort als Lebensmittelpunkt) und Zeit (mit dem Flugzeug überall schnell sein können). Das bedeutet aber auch, dass die Beziehungen höchst eingeschränkt vorhanden sind. Paarbeziehungen sind One-Night-Stands an der Hotelbar. Familie gibt es nicht bzw. man hat keinen Kontakt, Kommunikation findet in erster Linie online statt.
Das ist eine Welt der maximalen Freiheit, zugleich aber eine der maximalen Einsamkeit. Auf den Beginn des Lied-Refrains „I´m free“ folgt sogleich die zweite Strophe „free fallin´“. Der Halt, den dieses Leben bietet, findet sich nur mehr auf dem Bankkonto. Menschen, die so ein Lebensziel haben, vertrauen der Sicherheit des Geldes. Inzwischen wissen wir, dass diese Sicherheit trügerisch ist: Ein Bankkonto lässt sich mit einem einzigen Klick auf Null stellen. Konten können auf der Stelle eingefroren werden, manche russischen Oligarchen können davon ein Lied singen, auch wenn mir hier das Mitleid zur Gänze fehlt.
Zurück zum Thema. Auch die Gier nach Geld ist für unser Steinzeitgehirn ein lustvolles Ziel und wie überall gibt es auch hier keine Grenzen. Diese finden wir dann in der realen Welt, in erster Linie durch die endlichen Ressourcen unseres Planeten. Für unser Gehirn darf es das aber nicht geben, denn in seiner Entwicklung über die letzten zwei Jahrmillionen gab es keine Grenzen. Wenn ein Gebiet abgeweidet war, ist man mit der Viehherde einfach ein Stück weitergezogen. Hinter jedem abgeweideten Gebiet gab es ein frisches, und dahinter noch eins usw.
Auch die Ackerbauern konnten einfach ein Stück Wald roden und einen neuen Acker anlegen, um die steigende Kinderanzahl zu versorgen, abgesehen davon, dass sich die Bevölkerung über sehr lange Zeit nicht relevant vermehrt hat. Durch Überdüngung ausgelaugte Böden gab es auch nicht, lediglich die Bergbauern in den Alpentälern kannten Ressourcenknappheit. Auch für alle anderen gab es Dürre oder Überschwemmungskatastrophen, aber die waren relativ selten. Die Bergbauern mussten immer schon mit Knappheit umgehen, die Beschränkung war aber immer nur räumlich und temporär, nicht prinzipiell, wie im Anthropozän.
Die Konsumindustrie greift die Schwäche unseres Gehirns auf und zeigt uns eine schöne Welt des dauerhaften Überflusses. Darauf reagiert das Gehirn mit einer Art Dauergier auf alles. Dazu kommt noch das Angebot sofortiger Lustbefriedigung. „Ich will alles und das jetzt gleich“ ruft eine junge Frau in einem Werbespot.
Das beworbene Produkt verspricht ihr alles und das jetzt gleich zu geben – sie muss es nur kaufen. Unser Gehirn reagiert mit Glücksbotenstoffen, die allerdings immer nur kurz ausgeschüttet werden. Nach relativ kurzer Zeit ist das Glücksgefühl zu Ende und das Gehirn sucht nach Wiederholung.
Das ist der Trick des Ultra-Fast-Shoppings: Menschen gehen in das Geschäft, kaufen Kleidung, die sie sofort nach dem Kauf entsorgen, damit Platz ist, um ins Geschäft zu gehen und neue Kleidung zu kaufen. Angezogen wird diese Kleidung nicht, denn darum geht es nicht. Es geht um die Sekunden Dopaminausschüttung im Gehirn. Die Kleidungsstücke müssen daher auch nicht zum Tragen gemacht werden, sie sind aus billigen Materialien, die billig erzeugt werden, unter maximaler Ausbeutung von Mensch und Natur.
Dem Gehirn ist es egal, wo das Glücksgefühl herkommt. Es möchte in seinem Glück auch nicht gestört werden, daher blendet es die Informationen, die Botschaften aus, die sein Glück stören könnten.
Die Ultra-Fast-Shopper wollen nicht wissen, unter welchen Bedingungen ihre Mode erzeugt wird. Sie wollen einzig und allein eine ständige Wiederholung ihres Glücksgefühls mit möglichst wenig Energieaufwand.
Das Gleiche sehen wir bei der Nahrung: Eine leichte Berührung des Bildschirms unseres Handys führt dazu, dass kurze Zeit später die Türglocke klingelt und ein Bote das fertige Essen bringt. Wir brauchen dafür nicht auf die Jagd zu gehen und wir müssen auch kein Essen kochen, ein einziger Klick reicht.
Diesen Verlockungen kann das Gehirn schwer widerstehen. Es kann mit extrem wenig Energieaufwand ein Maximum an Energiezufuhr erhalten. Auch hier spielt die Herkunft des Zuckers (Energie) keine Rolle, die Qualität ebenso wenig, denn das Gehirn kann nicht in die Zukunft schauen, es lebt von der Energiezufuhr des Augenblicks.
Es ist ein Steinzeitgehirn, das über Jahrhunderttausende gelernt hat, dass das Hier und Jetzt zählt und dass das Morgen sowieso nicht planbar ist.
Die Anzahl der Menschen auf unserer Erde wächst und somit auch die Anzahl der zu befriedigenden Steinzeitgehirne. Somit muss die Konsumindustrie ständig wachsen, um die Gier möglichst vieler Menschen zu befriedigen.
Sie täuscht uns vor, dass wir zum Lebensglück nur die ständige Dopaminausschüttung des Gehirns brauchen. Die schöne Welt ist eine, in der wir uns sozusagen ständig unter Drogen befinden. Manche Menschen leben das tatsächlich mit Drogen, die sie dem Körper zuführen, sie gehen einen ähnlichen Weg und stürzen nur schneller und gründlicher in ihr Unglück.
Letztlich muss dieser Weg ins Unglück führen, weil man kann sich recht gut ausrechnen, was es für unsere Welt bedeutet, wenn viele Milliarden Menschen danach streben im Überfluss zu leben.
Eine beliebte Variante der Täuschung ist die Selbsttäuschung. Auch dafür gibt es unzählige Beispiele, die besten stammen aus dem Lieblingsfetisch der Österreicher, dem Auto.
Es ist schon wirklich viele Jahre her und ich hatte damals noch keinen Fotoapparat, aber das Bild immer noch in meinem Kopf: Ein VW Golf 1. Serie, ein 50-PS-Auto, der Besitzer hätte aber gerne einen GTI gehabt, also mit 110 PS und breiteren Reifen und roten Streifen rund um den Kühlergrill und selbstverständlich mit einem „GTI“-Schild auf der Heckklappe, damit alle wissen, dass er den schnellsten Golf besitzt, den es gibt.
Damit er es selbst glauben konnte, hatte er ca. ein Dutzend GTI-Schilder gesammelt und oben aufs Armaturenbrett geklebt.
Das Täuschungsmanöver ist auch bekannt unter „drei Faul ein Elfer“ (Fußballersprache) und scheint bei manchen Menschen zu funktionieren. Er wusste zwar, dass er keinen GTI hat, aber ab einer gewissen Anzahl an kleinen Schildchen, die er beim Fahren ständig vor Augen hatte, konnte er sich einreden, doch einen zu haben.
Diese kleinen Selbsttäuschungsmanöver ziehen sich durch viele Lebensbereiche. Wenn Menschen ihren Kindern Namen von Prominenten geben, die reich und schön sind, dann ist ihnen schon klar, dass die Chance, dass die Kinder einmal reich und schön werden, ausgesprochen gering ist. Aber vielleicht klappt es ja doch, und der 50-PS-Golf ist eines Morgens auf einmal ein GTI und das Kind gewinnt im Lotto.
Vielleicht wird die kleine Samantha Krcal ja einmal ein blondes Busenwunder wie das Vorbild Samantha Fox oder die kleine Gwyneth Huber einmal eine schöne, reiche Schauspielerin wie das Vorbild Gwyneth Paltrow.
Dummerweise passen die eigenen Nachnamen oftmals so gar nicht zu den amerikanischen oder sonstigen Vornamen, aber das tritt in den Hintergrund, zu stark dürfte der Wunsch nach einer Tochter sein, die gesellschaftlichen Aufstieg schafft.
Übrigens – wir haben auch noch andere Anteile in unserem Steinzeitgehirn. Wir können auch an die Gemeinschaft denken und uns in einen Verband eingliedern. Neben dem Egoismus gibt es auch das soziale Element und auch das hat einen evolutionären Hintergrund: Überlebt haben diejenigen Menschen, die eine Gemeinschaft gebildet haben, nicht die „Selektionisten“. Die starben oft stark, aber allein und dadurch doch nicht mehr so stark.
Stärke war nämlich die Stärke der Gemeinschaft, die gegenseitige Hilfe ermöglichte. Wir finden das glücklicherweise auch in den modernen Menschen, etwa wenn sie sich ehrenamtlich engagieren oder einem gestürzten Menschen aufhelfen, obwohl sie ihn nicht kennen.
Die Kooperation stellt sich gegen die Konkurrenz, die Nächstenliebe gegen die Egozentrik, die Empathie gegen die Soziopathie.
Welche Seite von einem neoliberalen Kapitalismus jeweils bevorzugt wird, brauche ich wohl nicht mehr zu erläutern.
Welche Seite letztlich gewinnen wird – mindestens durch eine gute Ausbalancierung, die derzeit leider nicht in Sicht ist, wird die Zukunft zeigen.
Dazu passt die alte Geschichte von den Wölfen, deren Ursprung wohl nicht zu finden ist, auch wenn sie gern den Cherokee-Indianern zugeschrieben wird.
Eines Abends erzählte ein alter Cherokee-Indianer seinem Enkelsohn am Lagerfeuer von einem Kampf, der in jedem Menschen tobt.
Er sagte: „Mein Sohn, der Kampf wird von zwei Wölfen ausgefochten, die in jedem von uns wohnen.
Einer ist böse. Er ist der Zorn, der Neid, die Eifersucht, die Sorgen, der Schmerz, die Gier, die Arroganz, das Selbstmitleid, die Schuld, die Vorurteile, die Minderwertigkeitsgefühle, die Lügen, der falsche Stolz und das Ego.
Der andere ist gut. Er ist die Freude, der Friede, die Liebe, die Hoffnung, die Heiterkeit, die Demut, die Güte, das Wohlwollen, die Zuneigung, die Großzügigkeit, die Aufrichtigkeit, das Mitgefühl und der Glaube.“
Der Enkel dachte einige Zeit über die Worte seines Großvaters nach, und fragte dann: „Welcher der beiden Wölfe gewinnt?“
Der alte Cherokee antwortete: „Der, den du fütterst.“
?
Eines Abends erzählte ein alter Indianer seinem Enkel vom Kampf, der in jedem Menschen tobt:
„In unserem Herzen leben zwei Wölfe. Sie kämpfen oft miteinander. Der eine Wolf ist der Wolf der Dunkelheit, der Ängste, des Misstrauens und der Verzweiflung. Er kämpft mit Zorn, Neid, Eifersucht, Sorgen, Schmerz, Gier, Selbstmitleid, Überheblichkeit, Lügen und falschem Stolz.
Der andere Wolf ist der Wolf des Lichts, des Vertrauens, der Hoffnung, der Freude und der Liebe. Er kämpft mit Gelassenheit, Heiterkeit, Güte, Wohlwollen, Zuneigung, Großzügigkeit, Aufrichtigkeit, Mitgefühl und Zuversicht!“
Der kleine Indianer dachte einige Zeit über die Worte seines Großvaters nach und fragte ihn dann: „Und welcher Wolf gewinnt?“ Der alte Indianer antwortete: „Der, den du fütterst.“
„Mein Sohn, in jedem von uns tobt ein Kampf zwischen zwei Wölfen. Der eine Wolf ist böse. Er kämpft mit Ärger, Neid, Eifersucht, Angst, Sorgen, Gier, Arroganz, Selbstmitleid, Lügen, Überheblichkeit, Egoismus und Missgunst. Der andere Wolf ist gut. Er kämpft mit Liebe, Freude, Frieden, Hoffnung, Gelassenheit, Güte, Mitgefühl, Großzügigkeit, Dankbarkeit, Vertrauen und Wahrheit.“
Der Sohn fragt: „Und welcher der beiden Wölfe gewinnt den Kampf?“ Der Häuptling antwortet ihm: „Der, den du fütterst.“
Ein alter Cherokee saß schon eine Weile mit seinem Enkelsohn schweigend am Lagerfeuer. Dann begann der Alte mit sanfter Stimme:
„In meinem Inneren kämpfen zwei Wölfe.“
Der Junge blickte ihn neugierig an.
„Der eine ist der Wolf der Dunkelheit, der Angst, des Neides, des Misstrauens und der Verzweiflung.“
Stille. Dann fuhr er fort:
„Der andere Wolf ist jener des Lichtes, der Liebe, der Lebensfreude und des Vertrauens.“
„Und wer von beiden gewinnt?“, wollte der Enkel wissen.
Der Großvater sah ihn an und lächelte: „Der, den ich füttere!“
Die Legende besagt, dass ein alter Cherokee-Indianer seinem Enkel die Lebensweisheit weitergab, die er selbst von seinem Grossvater erhalten hatte. Er erzählte seinem Enkel von einem inneren Kampf, der in jedem von uns stattfindet.
„Mein Sohn, in jedem von uns gibt es einen Kampf zwischen zwei Wölfen. Der eine Wolf ist böse – er ist Wut, Neid, Eifersucht, Kummer, Gier, Arroganz, Selbstmitleid, Schuld, Groll, Lügen, Überheblichkeit, Egoismus und Missgunst. Der andere Wolf ist gut – er ist Freude, Frieden, Liebe, Hoffnung, Gelassenheit, Bescheidenheit, Güte, Wahrheit, Mitgefühl und Glaube.“
Der Enkel dachte einen Moment nach und fragte dann: „Schön und gut, aber welcher Wolf gewinnt den nun von den beiden?“
Der alte Cherokee antwortete: „Der, den du fütterst.“
Ein Indianerhäuptling erzählt seinem Enkel folgendes Märchen:
„Mein Enkel, in jedem von uns tobt ein ewiger Kampf zwischen zwei Wölfen.
Denn, der eine Wolf ist böse. Er steht für das Negative in uns: Ärger, Neid, Eifersucht, Sorgen, Trauer, Gier, Arroganz, Selbstmitleid, Lügen, Überheblichkeit, Egoismus und Missgunst und vieles mehr.
Der andere Wolf jedoch ist gut. Er steht für Liebe, Freude, Frieden, Hoffnung, Gelassenheit, Güte, Mitgefühl, Großzügigkeit, Dankbarkeit, Vertrauen und Wahrheit und alles Gute in uns.
Dieser Kampf zwischen den beiden findet in jedem von uns statt, denn wir haben alle diese beiden Wölfe in uns.““
Der Enkel fragt: „Und welcher der beiden Wölfe gewinnt?“
Der Häuptling antwortet ihm: „Der, den du fütterst.“