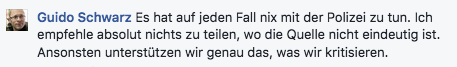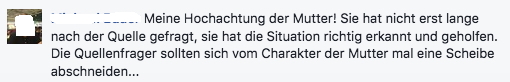Manchen meiner LeserInnen ist bekannt, dass ich ein Marmeladefreak bin – genauer gesagt, ich mache sie selbst, seit ca. 12 Jahren. Begonnen hat alles mit einem übervollen Marillenbaum in Greifenstein und dem Wunsch, qualitativ hochwertige Marmelade zu essen. Seitdem pflücke ich und koche ein, durchaus zur Freude vieler Menschen, die ich damit beschenke: meinen Freundeskreis, aber auch Kunden oder wer mir gerade einfällt.
Es steckt aber noch mehr dahinter und das möchte ich heute schildern.
Konkreter Anlass ist die Brombeermarmelade, die ich gerade fertig bekommen habe. Vor drei oder vier Jahren habe ich schon einmal 3-4 Gläser gekocht, gerade mal für den Eigenbedarf.
Da mir das aber nicht reicht, konnte ich letztes Jahr auf die Brombeeren meiner Mutter (kleiner Strauch) und die vom burgenländischen Haus meines Vaters zurückgreifen, was schon ca. 10 Gläser ergeben hat.
So richtig gut funktioniert das aber nur mit einem wirklich großen Brombeerschlag, den ich seit vielen Jahren suche. Letztes Jahr fuhr ich dann über einen kleinen Güterweg in der Nähe von Hintersdorf im Wienerwald. Links und rechts Brombeerbüsche und schon war die Idee dort heuer einmal vorbei zu schauen.
Auf die mögliche Ausbeute konnte ich mich den ganzen Winter und Frühling lang freuen.
Am Samstag war es dann soweit, im Zuge einer Vesparunde fuhr ich den Güterweg, der genau genommen für Kraftfahrzeuge gesperrt ist. Die Suchmission ergab: ja, Brombeeren. Wie viele ich genau würde pflücken können, war nicht klar, aber ich beschloss gleich am nächsten Tag in der Früh mit der Honda hinaus zu fahren, mehrere größere Plastikgefäße und ausgesprochene Pflücklaune mit dabei.
Am Sonntag kam ich genau bis Weidlingbach, dann machte mir das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Also um einen Tag verschieben und die verfahrene Stunde unter „leider nicht“ abbuchen.
Der Montag begann mit strahlendem Sonnenschein und ich starte wieder die Honda. Die Fahrt dauert ca. 30 Minuten und ich parke den Roller an der Hauptstraße, um mich zu Fuß Richtung Brombeeren zu begeben.
An dieser Stelle muss ich ein wenig ausholen. Marmelade ist etwas feines. Man kann sie aus einer Vielzahl verschiedener Früchte machen, von süß bis säuerlich, von dünnflüssig bis fest, pur oder gemischt und noch vieles mehr. Ich selbst mische nie, auch wenn das gerade der Trend ist. Kiwi-Stachelbeere-Mango brauche ich nicht, Marille oder Kriecherl schmecken mir besser.
Mit Marmelade erhalte ich den Sommer für den Winter und bringe süß in so manch saures Leben. Nicht ohne Grund handelt es sich auch um eine Kulturspeise, die es schon seit sehr langer Zeit gibt. Wenn man früher keinen Zucker hatte, so musste man halt besonders reife und süße Früchte einkochen und in Zeiten noch nicht erfundener Supermärkte war die Marmelade gemeinsam mit dem Honig die Zuckerreserve für einen langen Winter.
Es geht aber nicht nur um das fertige Produkt, Marmelade ist immer auch ein Ergebnis eines mehr oder weniger aufwändigen Herstellungsprozesses. Sie selbst herzustellen gibt ihr noch eine zusätzliche, persönliche Note, ganz abgesehen davon, dass man weiß, was drin ist. Ich schreibe das auch auf die Etiketten drauf: Früche, Quittin, Zucker. Mehr ist nicht notwendig.
Wir sind wieder zurück bei den Brombeeren. Sie gehören zu den Marmeladefrüchten, die sich dir nicht selbst schenken, Brombeermarmelade will erarbeitet sein, zumindest diejenige, die gut schmeckt.
Am einfachsten sind Erdbeeren: pflücken, in den Topf schmeißen, aufkochen, Zucker hinein – fertig. Dann folgen Marillen, die muss man nur entkernen und dann ist der Rest einfach.
Schwieriger wird es mit anderen Steinobstsorten. Weichseln muss man blanchieren, damit sie vom Kern gehen, Kriecherln ebenso und Zwetschken brauchen ohnehin eine eigene Art der Verarbeitung. Die Königin aller Steinobstsorten sind die Dirndln. Enorm viel Arbeit, dafür gehört Dirndlmarmelade zum feinsten, was sich der Marmeladeliebhaber vorstellen kann.
Mit Beeren ist es wieder anders. Hier liegt der erste Aufwand im Pflücken. Die Königin ist hier die Walderdbeere, von der man nahezu nie genügend findet, damit sich Marmelade auszahlt. Gleich dahinter rangieren Heidelbeeren, Himbeeren und Brombeeren, die letzten beiden halten noch die Herausforderung vieler kleiner Kerne bereit.
Ich liebe alle diese Beeren, konnte aber bisher eben nur Brombeeren verarbeiten. Was übrigens nicht funktioniert ist das Kaufen von Beeren. Die industriell hergestellten haben nur einen Teil des Geschmacks und genau der geht dann meist bei der Verarbeitung noch verloren, ganz abgesehen davon, dass es viel teurer wird als diese Marmelade zu kaufen.
Also selbst pflücken. Dazu muss man nicht nur wissen, wo eine ergiebige Quelle ist, sondern auch noch das Glück auf seiner Seite haben, damit nicht kurz vorher jemand den Brombeerschlag abgeerntet hat. Da Brombeeren nicht alle zugleich reif werden, kann man zwar ein paar Tage später wiederkommen, das ist aber irgendwie nicht so spannend.
Übrigens funktionieren auch die stachellosen Brombeeren nicht, denn mit den Stacheln wurde ihnen auch der Geschmack weggezüchtet, und genau um den geht es bei den Brombeeren.
Sie ergeben sich übrigens nicht kampflos und so zieht man besser Gewand an, das einigermaßen dornenfest ist. Auch gutes Schuhwerk ist zu empfehlen und vielleicht eine Kappe gegen die Sonne, die ich leider nicht dabei hatte.

Bild 1: Brombeerhecken haben Dornen
Ich marschiere also los und nach ein paar Minuten entdecke ich die erste, kleine Hecke. Sie trägt nur ganz wenige reife Beeren und ich rechne hoch, was meine Gesamtausbeute wird, wenn sich das nicht bessert. Zudem entdecke ich das, was ein Freund als „Tschernobyl-Brombeeren“ bezeichnet hat. Ein Großteil der Beeren einer Hecke besteht aus kleinen Früchten, die aus nur ganz wenigen „Perlen“ bestehen, die dafür aber riesig groß sind. Sie sehen wirklich aus wie Mutanten, wie pervertierte Brombeeren, und sie schmecken nach nichts. Da man sie zudem auch nur sehr schwer ernten kann, beschließe ich weiterzusuchen.
Ich marschiere auf dem Güterweg, auf dem nur von Zeit zu Zeit ein Mountainbiker vorbei kommt, in der heißen Augustsonne entlang und pflücke links und rechts immer wieder ein paar Beeren, die vor allem auf Hecken im Straßengraben wachsen. Das ist gar nicht so leicht, denn wenn man den entscheidenden Schritt nach vorne macht, um die 3-4 Beeren des Verlangens zu pflücken, steht man auf einmal im Graben und wird unsanft von Dornen aufgefangen.
Dazu kommt, dass so eine Brombeerhecke ein äußerst lebendiges Gebilde ist. Überall summt und brummt es, Fliegen, Wespen, Wanzen, Käfer aller Art plus Ameisen bevölkern in großer Zahl die Hecken und sind über Störung nicht allzu erfreut.
Ich habe nach einer Stunde gerade mal 20% meiner Behälter voll und rechne mit einem mittelprächtigen Desaster, da es immer mehr Tschernobyl-Hecken gibt und immer weniger mit guten Brombeeren. Dazu kommt noch, dass die wilden Brombeeren zwar gut schmecken, aber recht klein sind, was den Pflückaufwand noch einmal erhöht.
Durst hätte ich auch, leider aber kein Wasser mit. Dafür juckt es überall und ich bin schon ziemlich zerstochen, vor allem an den Unterschenkeln und Unterarmen. Die Hände sind längst pickig und tiefviolett von den Beeren. Dafür ist das Wetter schön und es ist so richtig Sommer, mit vielen Blumenwiesen und der warmen, würzigen Luft.
All das gehört zum Marmelade machen und steckt dann in jedem fertigen Glas.
Glücklicherweise entdecke ich eine längeren Abschnitt mit relativ guter Ausbeute. Die Hecke ist unter großen Bäumen und auf den ersten Blick nicht zu sehen. Erst wenn man näher kommt, offenbaren sich die Beeren in ihrer großen Zahl und Reife. Man braucht die nicht ganz reifen nicht zu pflücken, selbst wenn sie tiefschwarz sind, muss man vorher zupfen, um zu erkennen, wie reif sie sind.
Eine Marmelade aus reifen Brombeeren ist komprimierte Sonne mit Geschmack. Du kannst die heißen Sommertage auf der Zunge spüren und speziell die Brombeermarmelade hat immer einen sehr feinen Geschmack, den man sich erst erarbeiten muss.
Ich pflücke weiter und bin einigermaßen zuversichtlich, dass ich ca. 3/4 der Gefäße voll bekommen werde. Das ist nicht berauschend, aber kein Debakel. Inzwischen sind 2,5 Stunden vergangen und ich bin schon ein wenig matt. Eine Hecke mache ich noch.

Bild 2: Ein Gefäß ist schon halbvoll
Und genau das ist die Hecke mit dem Hattrick. Sowohl vorne als auch hinten hängen große Mengen an reifen und auch sehr großen Brombeeren. Hier dürfte schon 2-3 Tage niemand geerntet haben und ich kann in einer halben Stunde so viel pflücken wie in den zwei Stunden zuvor. Meine Körpergröße kommt mir jetzt zugute und ich erreiche ausgesprochen exponierte Heckenteile. Zudem spare ich mir noch mindestens eine Yoga-Einheit, denn die Verrenkungen sind wahrhaft meisterlich (und werden sich noch zwei Tage später spüren lassen).
Brombeeren pflücken ist echte Arbeit und geht der anderen echten Arbeit – einkochen – immer voraus. Brombeeren wollen erobert sein, dafür hat mir der Kosmos zum Schluss die reichhaltige Hecke geschenkt. Ein fairer Deal.

Bild 3: Brombeerhecke
Mit mehreren Kilo Beeren mache ich mich auf den Heimweg, verschwitzt und durstig, aber glücklich ob der fetten Beute.
Leider ist es damit nicht getan, die nächste Herausforderung wartet beim Einkochen. Wie schon erwähnt, haben Brombeeren Kerne, und zwar nicht zu wenige. Manchen Genießern ist das egal, die meisten jedoch mögen keine Kerne, weil sie immer in den Zähnen stecken bleiben und außerdem ein wenig angenehmes Esserlebnis bewirken.
Also müssen sie raus, was wiederum das Problem ergibt, dass dann der Geschmack ebenfalls draußen ist. Also gehe ich einen Mittelweg und koche die Brombeeren auf, um sie dann einmal durch die flotte Lotte zu jagen. Dieses Gerät ist für Marmeladeköche unabdingbar, man braucht es für fast alle Marmeladesorten.
Ein kleiner Tipp: beim Kauf einer flotten Lotte nicht sparen, hier wirkt sich Knausrigkeit auf jeden Fall über lange Jahre negativ aus.
Die guten Geräte sind aus Edelstahl und haben Einsätze mit verschiedenen Lochgrößen. Für Brombeeren nimmt man die kleinste und passiert die Beeren einfach durch. Das spritzt meist ein wenig und verursacht äußerst hartnäckige Flecken überall in der Küche.
Wichtig ist, dass man die Brombeeren nur 1x durch die flotte Lotte reibt, was ca. 3/4 der Kerne entfernt. Mit dem letzten Rest an Kernen muss man leben, denn wenn man die auch noch entfernen will, geht auch der Geschmack verloren. Man kann dann noch Brombeergelee machen, das gibt aber nicht viel her – das einzige Gelee, das funktioniert, ist Ribiselgelee, weil dort der Geschmack intensiver ist.
Die nächste Herausforderung ist die Zuckermenge. Brombeeren haben einen einigermaßen hohen Eigenpektinanteil, trotzdem braucht man Geliermittel. Ich verwende Quittin. Dabei ist wichtig, dass man zuerst die Früchte samt Quittin aufkocht und erst dann den Zucker hinein gibt. Ich bevorzuge 2:1, also zwei Kilo Früchte und ein Kilo Zucker. Das ist keine Garantie, dass die Marmelade ordentlich ausgeliert, aber meistens funktioniert es. Gibt man mehr Zucker hinein, dann geliert sie deutlich leichter, verliert aber auch deutlich an Geschmack.
Der letzte Tipp betrifft das Abfüllen. Ich verwende am liebsten gebrauchte Gläser, die ich aus meinem Bekanntenkreis zusammensammle. Die perfekten Gläser sind diejenigen mit Klick-Verschluss, der im Deckel eingebaut ist. Ich persönlich mag das gerne empfohlene Umdrehen der Gläser gar nicht. Erstens erhöht sich die Schimmelbildungswahrscheinlichkeit, weil die Deckel am schwierigsten sauber zu bekommen sind und zweitens ist das dann eine Schweinerei beim ersten Öffnen, ganz abgesehen davon, dass es grauslich aussieht.
Ich koche am liebsten am frühen Abend ein. Wenn ich dann in´s Bett gehe, höre ich wie ein Glas nach dem anderen dicht macht: Plopp… plopp… plopp.
Am nächsten Tag kommt noch ein Etikett drauf und dann harren die Gläser ihrer Verschenkung an Menschen, die gute, selbstgemachte Marmelade zu schätzen wissen.
Der Zeitaufwand ist beträchtlich, bei der Brombeermarmelade betrug er diesmal 20 Minuten pro Glas. Dafür halte ich ein selbst gemachtes Produkt in den Händen, biologisch einwandfrei und aus lokalem „Anbau“.

Bild 4: Die fertigen Gläser