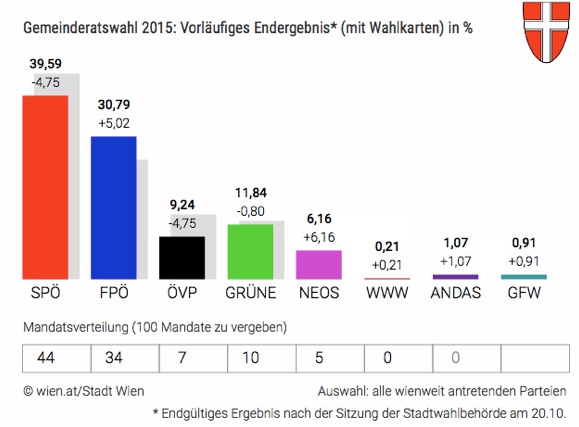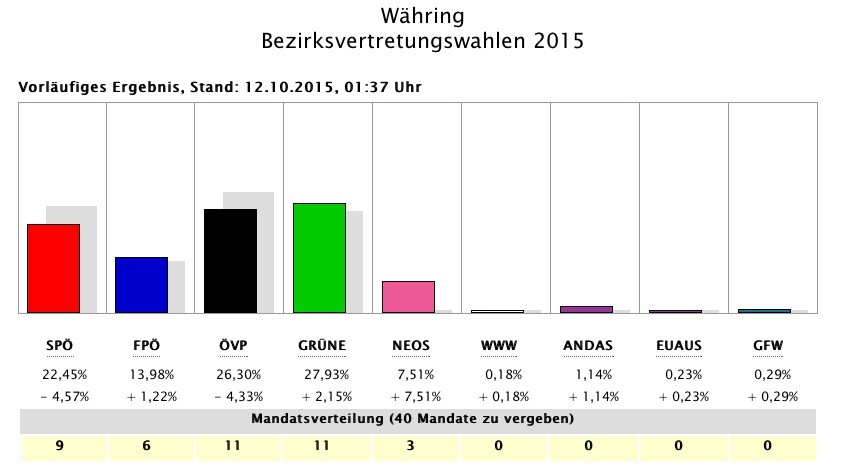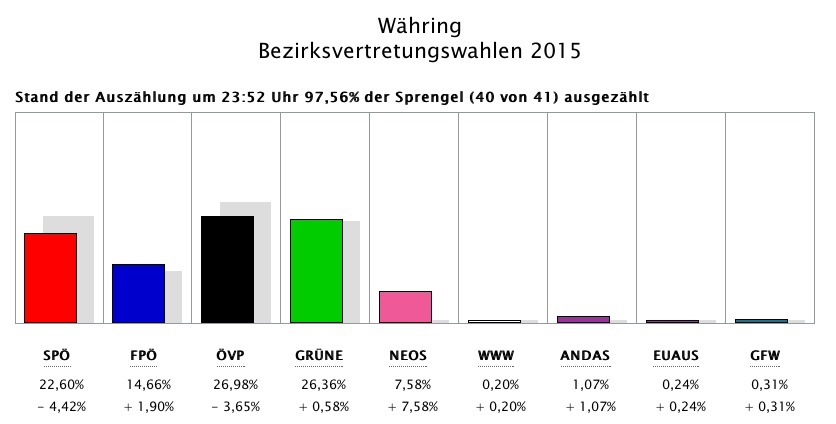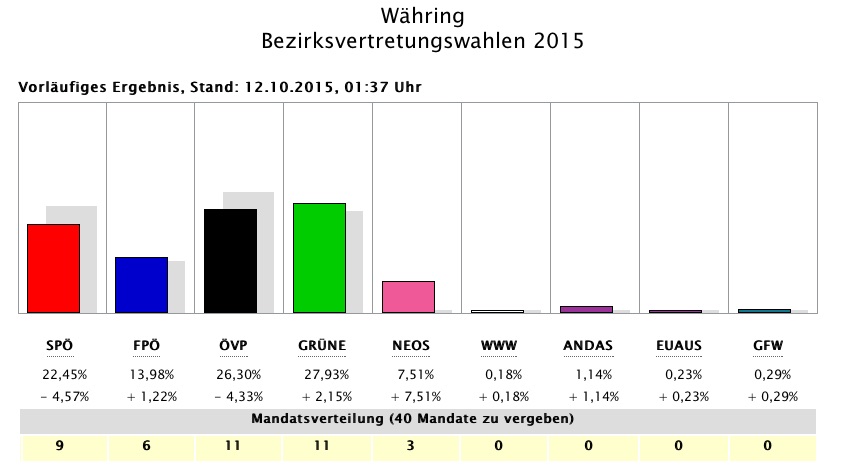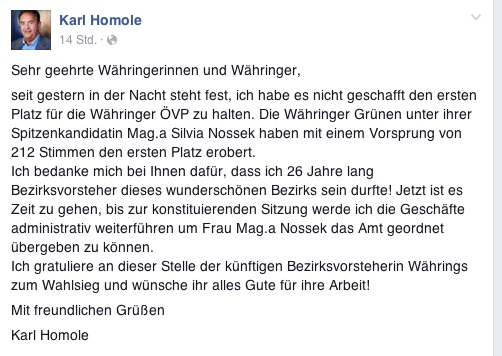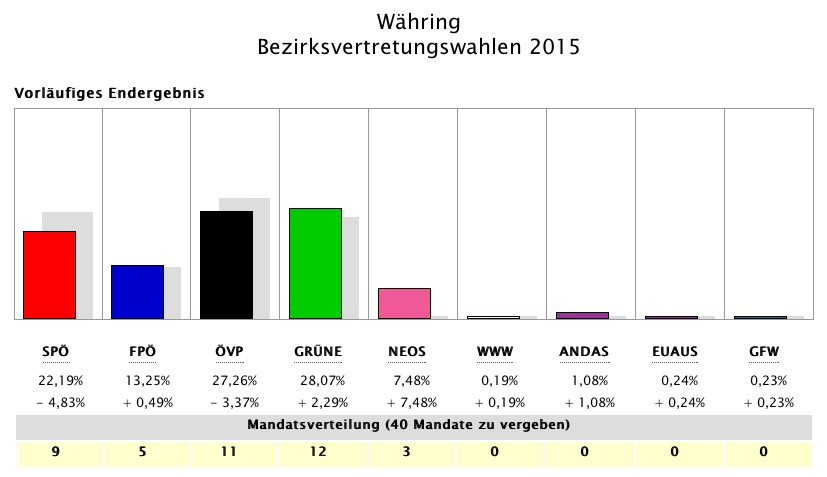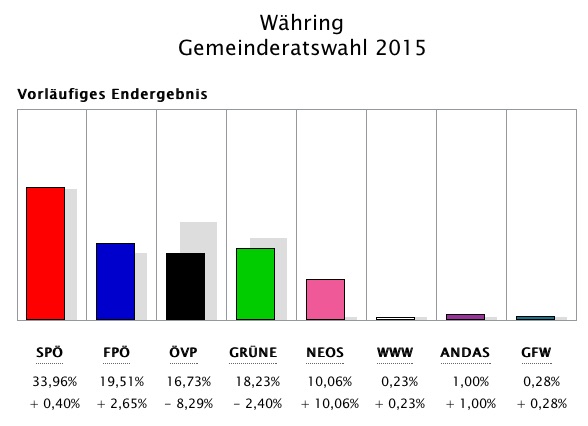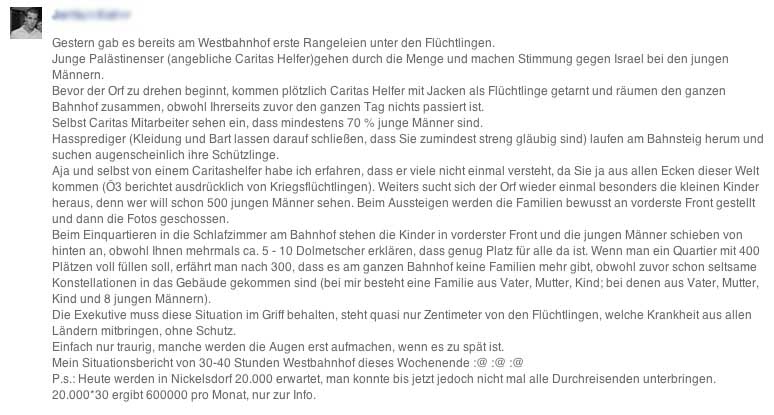Seit dem Tod vom alten Herrn Kudlicka möchte ich sein Grab in Rijeka besuchen. Selbstverständlich geht das nur mit einer alten Vespa, also plane ich seit mehr als zwei Jahren eine Tour an´s Meer.
Albert Kudlicka wurde 81 Jahre alt und stand bis wenige Monate vor seinem Tod noch im Geschäft. Vespa war sein Leben. Ich durfte ihn ca. eine Woche vor seinem Ableben in der Palliativ im Wilhelminenspital besuchen, wo er mir etliche interessante Geschichten aus seinem Leben erzählte – etwa seine Vergangenheit als Münzsammler. Er legte so die Basis für sein späteres Einkommen und stammt – wenn ich mich richtig erinnere – aus einem kleinen Ort namens Bakar etwas südlich von Rijeka.
Ich durfte mir ca. eine halbe Stunde ein Video von seinem traumhaften Haus in Medveja ansehen, während er schlief und dann eine Suppe aß, die ihm sein Mechaniker ins Krankenzimmer geschmuggelt hatte („viel besser als das, was sie hier haben“).
Eine Woche später schied er aus dem Leben und ich hatte die Ehre, eine kleine Rede auf seiner Seelenmesse am Ottakringer Friedhof zu halten. Links saß die Familie, rechts saßen die Vespafahrer. Herr Kudlicka wurde eingeäschert und dann am Friedhof von Rijeka beigesetzt.
Ich war in den 1990er oft in Kroatien und erinnere mich noch gut an das erste Wochenende, als ich mit meinen Freunden Gabor und HiHo im ausgeborgten Audi meines Vaters nach Istrien fuhr. Ein Freund von Gabor hatte damals ein kleines Bauernhaus gekauft, in dem wir die zwei Nächte wohnen durften. Es lag in „Sveti Anton“ (St. Anton), einem winzigen Bergdorf oberhalb von Mosenicka Draga. Als wir damals im Sommer 1993 dort ankamen, stellte es sich als bessere Ruine heraus, ohne Sanitäreinrichtungen, Wasser oder Strom. Wir waren aber zum Tauchen dort und außerdem ein wenig jünger als heute und hielten es auch ohne Luxus gut aus.
Am letzten Tag spazierten wir durch Medveja und Gabor sah sich ein schönes Schiff näher an. Es lag an der Mole und er lernte Jani kennen, einen Slowenen, der mit seiner Wiener Frau eine Tauchbasis betrieb. Das Schiff (die „Vranjak“) hatte er gepachtet und unternahm damit Tauchsafaris an der dalmatinischen Küste.
Auf diesem Bild sieht man die Mole, an der die Vranjak damals lag:

Die traumhafte Villa oberhalb der Mole ist die Villa Susmel, wahrscheinlich das schönste Haus in der ganzen Gegend, weil sie in unglaublich toller Lage liegt, genau am nördlichen Kap der Bucht von Medveja, mit riesigen Grundstück und eigenem Meerzugang.
Jani hatte auch diese Villa gemietet und wir verbrachten dort einige Tauchurlaube und sogar Silvester 1994.
Ca. 1997 musste Jani die Villa aufgeben, danach befand sich darin eine Computerfirma und heute ist sie in privater Hand. Hier ein Bild, das ich von der Straße aus geschossen habe:

Viele Jahre lang wollte ich wieder nach Kroatien fahren und versuchte immer wieder eine Kreuzfahrt auf der Vranjak zu organisieren, die inzwischen von Jani´s Sohn betrieben wird, doch es wurde nie was draus.
Dann hatte ich die Gelegenheit am 40. Geburtstags meines lieben Vespa-Freundes Hannes ausführlich mit Sergio zu plaudern, dem Schwiegersohn von Albert Kudlicka. Ich kannte ihn bisher nur als eher mürrischen Typen, seines Zeichens seit immer schon die Nr. 2 im Geschäft vom alten Kudlicka. Viele glauben bis heute, dass er der „Radakovits“ ist, der ehemalige Geschäftspartner, mit dem der Kudkicka seinerzeit in den 1970ern das Geschäft gegründet hat.
Ich erfuhr, dass die Familie von Sergio aus Sveti Anton stammt und er selbst ein Haus in Mosenicka Draga hat. Und dass die Villa vom Albert Kudlicka keine 100 Meter neben der Villa Susmel steht. So schließen sich die Kreise und so entstand auch der Gedanke – schätzungsweise im Frühjahr 2013 – wieder einmal dorthin zu fahren.
In den darauf folgenden beiden Sommern klappte es nicht, denn ich hätte jeweils alleine fahren müssen und außerdem hatte ich keinen Motor in meiner Vespa, dem ich ausreichend vertraut hätte. Nach der stressigen Rom-Reise 2012 hatte ich außerdem beschlossen, dass ich so weite Strecken nicht mehr allein fahren möchte. Dazu kamen letztes Jahr noch die drei bitteren Todesfälle in meinem Freundeskreis, die mich im Sommer beschäftigten.
Und dann kam 2015. Schon im Frühling schrieb ich mein Interesse an der Tour ins Internet und etliche Freunde meinten, da würden sie gerne mitfahren. Da wir aber in einer Zeit der Unverbindlichkeit leben, blieb am Schluss wieder ich alleine übrig.
Doch dann fiel der Entschluss: ich fahre! Da der von mir neu aufgebaute Polini-Motor zwar sehr gut lief, sich aber trotzdem irgendwie nicht gut anfühlte (schwierig zu beschreiben, „überlastet“ obwohl er es nicht sein sollte, viel zu helle Zündkerze…) beschloss ich am Vortag noch einen Standard-200er einzubauen. Den hatte ich startfertig daheim liegen und vor zwei Jahren auch schon getestet. Damals lief er problemlos
An dieser Stelle wird ein kleiner Einschub fällig, zumindest für diejenigen, die meine Rom-Reise nicht kennen. Alte Vespas sind tendenziell anfällig, weil die modernen Ersatzteile oft von schlechter Qualität sind und sich außerdem hin und wieder Fehler einschleichen. Auf meiner Rom-Reise hatte ich insgesamt 11 Pannen und das wollte ich um jeden Preis vermeiden. Die Sprint-Vespa ist mein Tourenfahrzeug und soweit gut in Schuss. Blieb noch die Frage nach dem richtigen Motor.
Beim bisher eingebauten Polini-Motor hatte ich nie ein wirklich gutes Gefühl. Das bedeutet, dass ich beim Fahren ständig auf den Motor höre: kreischt da etwas? Scheppert da irgendwo was? Klingelt der Motor? Stottert er oder vibriert er mehr als üblich? Fühlt er sich zu heiß an? Was ist auf einmal dieses komische Dröhnen? Was wird an der nächsten Steigung passieren?
Diese und noch mehr Ängste und Gedanken machen mich fertig. So will ich nicht weite Strecken fahren. Rund um Wien – kein Problem, da kann ich mir immer irgendwo helfen. Wenn aber irgendwo in Slowenien mitten im Nirgendwo der Motor seinen Geist aufgibt – so etwas hatte ich schon, so etwas will ich nicht mehr. Natürlich geht die Welt nicht unter und ein gewisses Risiko bleibt immer, aber bereits in Wien mit einem Motor wegfahren, dem ich überhaupt nicht vertraue – sicher nicht.
Also wurde umgebaut, mein lieber Freund Bobby half mir dabei und nach drei Stunden war die Vespa reisefertig. Als Auspuff wählte ich einen gebrauchten SIP Road 1. Serie, den ich gut kenne und der ein wenig kerniger klingt und geht als der originale.
MITTWOCH
Mittwoch früh, ich stehe gegen 06.30 auf und komme ca. um 07.15 weg. Die geplante Route führt mich ohne Autobahn bis nach Klagenfurt, meinem heutigen Tagesziel. Die Vespa springt gut an und schnurrt brav dahin, wenngleich ich jetzt schon merke, dass der Kraftverlust gegenüber dem Polini-Motor erheblich ist. Das stört aber nicht, denn ich habe sowieso vor eher gemütlich zu fahren, also so 80 km/h mit Tendenz leicht nach oben, schließlich will ich irgendwann auch ankommen.
Ich muss noch zwei Bücher zur Post bringen, doch die hat noch zu und ich verlasse Wien.
Enorm ist der Temperaturunterschied zwischen der Stadt und außerhalb. Ich bin wie seinerzeit bei der Rom-Reise nur mit meiner Airflow-Jacke bekleidet, die unglaublich genial bei Hitze und unfahrbar bei Kälte ist. Ich fahre diesmal mit sehr wenig Gepäck, die dichte Regenjacke ist aber dabei und leistet jetzt gute Dienste.
Über Auhof fahre ich nach Wolfsgraben, dann über Gruberau und Klausen-Leopoldsdorf meine Rom-Route von vor drei Jahren. Dann jedoch schlage ich eine andere Route ein und fahre über Laaben und die Klammhöhe nach Hainfeld. Dort läuft mir ein freundlicher Postler über den Weg und wenige Minuten später ist der letzte Ballast weg, die Fahrt kann weitergehen.
Es wartet die berühmte Kalte Kuchl, vor der viele Motorradfahrer seit vielen Jahren Respekt haben, weil es dort erstens eine 70er-Beschränkung gibt und diese zweitens sehr rigoros überwacht wird. An sonnigen Sonntag-Nachmittagen kann man einen ganzen Haufen geparkter Motorräder finden, die alle ohne Nummerntafel herumstehen.
Mich interessiert das wenig, denn mit der Vespa komme ich eh nicht über die 70. Die Fahrt ist angenehm, ganz jedoch kann ich meine Angewohnheit, irgendwie ständig oder zumindest öfter auf den Motor zu hören, nicht ganz ablegen. Ich hoffe, dass sich das mit der Zeit gibt und sich Vertrauen in den Originalmotor einstellt.
Hier ein Bild von meiner kurzen Rast in der Kalten Kuchl. Vespas sind hier eher selten zu sehen.

Die Höchstgeschwindigkeit der Sprint liegt bei knapp über 90 und sogar da wirkt sie schon am absoluten Ende der Fahnenstange. Der Motor dreht im 2. und 3. Gang gut rauf, nur oben ist dann Schluss, die Vierte dreht lange nicht so frei wie sie müsste (trotz 118 Hauptdüse, eh klein für den SIP Road). Mein Verdacht richtet sich gegen den Auspuff – wenn der verlegt ist, ergibt es genau diese Symptome. Spielt aber keine Rolle, ich kann das jetzt eh nicht ändern. Vielleicht putzt er sich ja frei.
Über St. Aegyd am Neuwalde geht es nach Mariazell, wo der erste Tankstopp fällig wird. Bisher ist es eine völlig problemlose Fahrt über eine absolut empfehlenswerte Strecke. Die Vespa mit ihrer Gepäckrolle hinten drauf ruft fast überall freundliche Gesichter hervor, sogar ein paar schnelle Motorradfahrer haben mich gegrüßt.
Über Gußwerk geht es weiter nach Wildalpen. Das ist eine meiner alten Motorrad-Lieblingsstrecken, eine Kurvenorgie ohne Ende. Weniger spannend ist dann das Gesäuse und in Admont wird es Zeit für eine Mittagspause. Beim Nah&Frisch sind alle mit mir per Du und ich merke, dass ich schon echt weit weg bin von Wien.
Nach einer eher kurzen Pause treibt es mich weiter. Über eine tolle Bergstraße geht es nach Trieben. Auf der Passhöhe befindet sich ein kleines Skigebiet, das scheinbar gerade für eine Beschneiungsanlage umgebaut wird. Das ist ein unglaublicher Eingriff in die Naturlandschaft, nicht nur der riesige Wasserspeicher, das folgende Bild zeigt nur einen Ausschnitt der großflächigen Zerstörung:

Schon in Mariazell hab ich das erste Mal meinen Nacken gespürt. Ich kenne das leider schon von der Romreise, dass sich durch die Sitzhaltung bei meiner Größe und der für Italiener gebauten Vespa die Nackenmuskeln verspannen und dann bis zum Ende des Tages schmerzen. Ich mache immer wieder kleine Entspannungsübungen, aber das hilft nur wenig. Eine zeitweise Veränderung der Sitzposition bringt auch ein wenig, aber eben nicht viel. In Trieben wird der nächste Tankstopp fällig, danach geht es auf die große Bundesstraße Richtung Hohentauern. Diese Strecke habe ich viel weniger steil und auch weniger kurvig in Erinnerung – aber ich bin sie das letzte Mal vor über zehn Jahren mit einer Aprilia Pegaso gefahren und der Vergleich ist nur bedingt sinnvoll.
Trotzdem: bisher eine großartige Strecke und der Motor hält, wenngleich er auch bergab nicht über 110 zu bringen ist, das ist eindeutig um 10 bis 15 km/h zu langsam für einen Standard-200er. Wie auch immer, ich kann es nicht ändern und will auch nicht anfangen, irgendwo herumzuschrauben.
Dann geht es auf der mir gut bekannten Strecke nach Scheifling und hinauf zum Perchauer Sattel. In Neumarkt zweige ich links ab und fahre nicht die normale Route nach Klagenfurt, weil die eher fad ist. Von Neumarkt geht es über Brückel eine sehr nette Strecke bis direkt nach Klagenfurt – absolut empfehlenswert. Besonders interessant: Gefühltermaßen geht es nur bergab, ich hatte den Eindruck, ich könnte selbst bei einem Motorschaden fast bis Klagenfurt rollen.
Bei der Ortseinfahrt hupt mich ein Autofahrer an. Als ich mich umdrehe, zeigt er mir den Daumen nach oben – das sind die kleinen Momente, wo die Schmerzen im Nacken nachlassen und auch der Hintern nicht mehr so weh tut.
Die Regenjacke habe ich bis nach Hohentauern getragen, jetzt ist es sehr warm und die Airflow-Jacke erledigt ihren Job bravourös. Nur bei der knielangen Hose bin ich mir nicht sicher, ob ich mir nicht das eine oder andere Insekt einfange, das wäre eher weniger angenehm, so ein Wespenstich in die Weichteile…
Egal, ich riskiere das einfach.
Ein bis zwei Mal hatte ich heute schon leichte Warmstartprobleme, aber die sind jetzt auch verschwunden, der Motor hat gut bis Klagenfurt gehalten und zeigt keine Veränderung, was ich als gutes Zeichen interpretiere.
Meine Gastgeber Norbert und Ute haben mich lange nicht gesehen und gemeinsam fahren wir noch mit dem Radl am Ländkanal bis zum Loretto-Strandbad, um ein kühles Bad im Wörthersee zu nehmen. Das entspannt auch den Nacken ein wenig und ich bin froh, den ersten Tag gut überstanden zu haben.
Im Gegensatz zu Wien kühlt es in Klagenfurt in der Nacht ein wenig ab und so schlafe ich gut und fest.
DONNERSTAG
Ich merke leichtes Reisefieber, das wirkt sich bei mir in absoluter Appetitlosigkeit aus. Glücklicherweise brauche ich bis zu Mittag kein Essen und breche gegen 8 Uhr auf. Die Luft ist kühl und erfrischend, diesmal habe ich die Regenjacke schon bei der Abfahrt angezogen. Jetzt wartet der Loibl-Pass auf mich, den ich das letzte Mal vor 19 Jahren gefahren bin. Damals sind wir von einer langen Tauchtour zurück gekommen und ausnahmsweise über Klagenfurt heimgefahren. Es war mitten in der Nacht und es gab keine Grenzposten – die hatten sich alle schlafen gelegt. Wir blieben stehen, warteten eine Weile und fuhren dann einfach weiter.
Der Loibl ist sehr steil und kurvig, aber schön zu fahren.

Auf der slowenischen Seite gibt es ein Kriegsdenkmal, denn die Straße wurde seinerzeit mit Zwangsarbeitern errichtet.

Auf dem Parkplatz davor steht ein uralter Opel Rekord Caravan (ein „C-Rekord“), mit einem Hänger, auf dem zwei Mopeds stehen. Das junge Pärchen versucht gerade die Kiste wieder flott zu bekommen und der holländische Fahrer erzählt mir, dass sich die Gänge nicht mehr schalten lassen. Außerdem würden sich ständig die Ventile verstellen, aber er bekäme das schon in den Griff. Schließlich müssten sie heute nur noch bis Holland und er meint, wenn er unter das Auto kriecht, kann er den dritten Gang manuell einlegen und dann damit durchfahren. Ich erkläre ihm, dass es bis zur Passhöhe nicht mehr weit ist und gebe ihm noch Info über die Straßenbeschaffenheit danach.
Dann geht es hinunter nach Kranj, die Straßen sind sehr gut und ich habe mir eine Route quer durch Slowenien ausgesucht. Auch diesmal werde ich nicht enttäuscht, es sieht ein wenig aus wie in der Steiermark, alles ist sehr sauber, gepflegt und die Landschaft ist durch kleinstrukturierte Landwirtschaft geprägt. In jedem größeren Ort gibt es einen Hofer, einen Lidl, einen Spar und eine OMV-Tankstelle. Oft auch eine Burg.

Ich durchquere einige kleinere Orte (Skofia Loka, Gorenja vas und Ziri) und muss mit dem einzig schlechten Straßenstück überhaupt kämpfen (zwischen Ziri und Logatec). Mein Zwischenziel ist Postojna, wo ich auch den nächsten Tankstopp einlege. Ab da brauche ich die Regenjacke nicht mehr, es ist wieder sehr heiß und ich fahre ab jetzt direkt in südlicher Richtung. Bei Pivka gibt es eine kleine Abzweigung, die zu einer ziemlich bekannten Abkürzung führt, nämlich durch den slowenischen Karst rund um den Ort Knezak. Diese Abkürzung sind wir in den 1990ern immer gefahren, manchmal auch in der Dunkelheit, was irgendwie eine ganz eigene Atmosphäre hat. Etwa in der Mitte der Strecke fährt man auf einen einsamen Friedhof zu und kurz davor kommt eine scharfe Kurve – es ist wie in einem Videospiel. Die Abkürzung geht bis Ilirska Bistrica und ist 16 km lang. Irgendwo auf der Strecke mache ich Mittagspause und esse eine Wurstsemmel. Die Nackenschmerzen sind verlässlich und pünktlich zur Stelle und weigern sich wieder abzuhauen.

Vor vier Jahren sind wir zur exakt gleichen Zeit nach Krk zum Tauchen gefahren, Mario, mein Bruder und ich. Damals dachten wir beim Stau in Ilirska Bistrica an eine Ampel, eine Baustelle oder einen Unfall, bis wir feststellen mussten, dass es der bis hierher zurück reichende Grenzstau war, satte zehn Kilometer im Schritttempo. Das werde ich nie vergessen.
Diesmal ist alles frei, wobei mich ein Stau mit der Vespa eh nicht interessiert hätte. Aber so denke ich mir, dass es nicht schwer sein wird in Baska (mein Zielort für heute) ein Quartier zu finden. Vor vier Jahren waren wir mitten im Ferragosto und hatten Problem unser reserviertes Quartier auch zu bekommen.
An der Grenze gibt es noch zwei echte Passkontrollen, dann bin ich in Kroatien. Weil ich nicht auf der Autobahn fahren will, wähle ich die schlecht beschilderte Abfahrt und hoffe, dass ich richtig liege.
Die Kroaten und auch die Slowenen wollen mit ihrer Beschilderung offensichtlich bewirken, dass man auf der mautpflichtigen Autobahn fährt bzw. bleibt. Ich lasse mich davon nicht beeindrucken und finde die richtige Bundesstraße (Nr. 8), die mich hinunter nach Rijeka führt. Aber auch dort gerate ich am südlichen Ende der Stadt in die Autobahnfalle und bin plötzlich in einem Zubringertunnel. Ich muss an dieser Stelle erwähnen, dass ich mit der alten Vespa äußerst ungern Autobahn fahre. Erstens kostet es sinnlose Maut und zweitens ist es bei einer Panne irgendwie noch unangenehmer als auf einer Landstraße. In diesem Fall ist es doppelt blöd, weil ich keine Vignette habe und im Falle einer Panne dadurch wahrscheinlich ein ernsthafteres Problem.
Ich komme jedoch ungeschoren bis zur nächsten Abfahrt und nehme diese, um wieder auf die Bundesstraße zu kommen. Ich kenne sie noch von vor vier Jahren und fahren hinunter nach Bakar, dem eigentlichen Heimatort von Albert Kudlicka. Dort ist es nicht sehr lauschig, weil es ein größeres Öllager gibt und die gesamte Bucht nach Mineralöl riecht. Genau dort unten befindet sich der kleine Ort Bakarac, in dem ich eine kleine Pause einlege.
Es ist inzwischen extrem heiß und ich gönne mir eine kalte Flasche Mineralwasser. Der nette Kellner grinst und bringt mir eine Römerquelle.

Endlich am Meer! Ich weiß, dass es bis Krk nicht mehr weit ist und wähne mich schon am Ziel. Genau genommen ist dieses Ziel der „Saloon“, ein sensationelles kroatisches Lokal, dessen Essen reichlich, hervorragend und günstig ist. Dort haben wir vor vier Jahren vorzüglich gespeist und dort ist mein heutiges Etappenziel.
Also nichts wie hin. Die Vespa läuft sehr brav und ich komme zur Mautstelle an der Brücke, die über den Velebitkanal führt und Krk mit dem Festland verbindet. Der nette Kassier fragt mich, ob ich mit der Vespa aus Österreich bis hierher gefahren bin und schüttelt lächelnd den Kopf.
Die Straßen sind auf Krk hervorragend, was sich in den letzten vier Jahren deutlich verändert hat, ist die enorm gestiegene Anzahl an Shoppingcentern, die überall zu finden sind (es gibt dort einen KONZUM).
Die Strecke nach Baska zieht sich, vor allem weil ich hinter einigen Wohnwägen hertuckern muss. Doch irgendwann habe ich den schmalen Pass überwunden, hinter dem es nach Baska hinunter geht. Ich erreiche mein Ziel, parke die Vespa gegenüber des „Saloon“ und entdecke den Chefkellner, an den ich mich noch erinnere.
Ich frage ihn, ob es den Chef noch gibt und er deutet auf einen Tisch. Ich erkenne ihn erst auf den zweiten Blick, es ist ein witziger Typ, der einen unglaublich dicken Bauch hat. Er dirigiert dieses Lokal indem er davor steht und die Gäste empfängt. Er erkennt schon von weitem die Nationalität der Gäste und spricht sie in ihrer Sprache an. Die Hütte ist immer ausnahmslos zum Bersten voll und trotzdem bekommt man irgendwie einen Platz. Er fragt sofort „wie viele?“ und wenn man draußen ein wenig warten muss, dann bekommen die Kinder einen Schlecker und die Eltern einen Schnaps.
Als ich ihm erzähle, dass ich jetzt Quartier suchen werde, bricht der ganze Tisch in schallendes Gelächter aus, was mir ein wenig Flauheit im Magen verschafft. Andererseits: das muss zu schaffen sein, ein billiges Quartier für eine Person, ohne jeden Komfort, ich brauche nur ein Bett und eine Dusche.
Also mache ich mich auf die Suche nach einer Pension. Die ersten drei Agenturen winken freundlich ab und meinen, dass das hier genau am stärksten Wochenende sehr schwierig sein würde.
Aber ich solle am besten noch in anderen Agenturen fragen oder in ein Hotel gehen, davon gäbe es zwei hier in Baska (plus noch eines mit Zimmern ab 250,- pro Nacht, was doch über meinem Budget liegt).
Also frage ich bei anderen Agenturen und einigen privaten Häusern. Die erste Frage lautet immer „wie viele Personen“ und die zweite Frage „für wie lange“.
Alleine und für eine Nacht hat man die Arschkarte, so viel stellt sich heraus, als mir das Tischgelächter im Ohr nachklingt, meine Dehydrierung langsam zu- und mein Energielevel abnimmt.
Das darf doch nicht wahr sein! Ich beschließe zum kleineren der beiden Hotels zu fahren. Dort sitzt ein eher unfreundlicher Typ, der meint, er hätte noch ein Zimmer und das würde 75 Euro kosten, inklusive Halbpension. Auf meine Frage, ob ich es auch nur mit Frühstück haben könnte, meint er „das ist der Preis – wie auch immer.“
Ich beschließe noch in das andere Hotel zu schauen und vielleicht noch in 2-3 Agenturen. Aber auch dort habe ich kein Glück und bin inzwischen genervt und kaputt. Also dann doch das teure Hotelzimmer.
Als ich ankomme, merke ich schon am Blick des Unfreundlichen, dass was nicht stimmt. „Ich habe das Zimmer gerade einer jungen Familie gegeben, tut mir leid.“ meint er.
Dann erbarmt er sich insofern als er mir eine Broschüre mit Hotels und Pensionen auf ganz Krk gibt. Ich solle es im Ort Krk probieren, denn im Nachbarort Punat (wo wir vor 4 Jahren gewohnt haben) wäre auch alles voll, aber auf Krk gäbe es insgesamt mehr Betten.
Ich setze mich in ein Kaffeehaus und trinke einen halben Liter Wasser auf ex. Leichte Enttäuschung und Verzweiflung tauchen auf – muss ich wieder zurück fahren, und wenn ja, bis wohin? Ich sehe mich schon irgendwo hinter einem Busch im Staub übernachten und greife zum Telefon. Im kleinen Ort Silo gibt es leider auch kein Quartier mehr, ich telefoniere alle Agenturen durch, keine Chance. Nur einen Wohnwagen gäbe es, für 60 Euro.
Dann beschließe ich nach Krk zu fahren. Am Weg dorthin bleibe ich noch in zwei Ortschaften vor Baska stehen und klappere ein halbes Dutzend Agenturen und Privatquartiere ab. Einzig eine nette Dame meint, sie hätte noch ein Kellerapartment und wenn bis 9 Uhr Abends niemand käme, dann könnte ich es haben, für 60 Euro.
Das ist mir zu unsicher und ich starte die Vespa. Schade, aus dem Abendessen im Saloon wird nichts, das ist irgendwie ein persönlicher Rückschlag.
Dazu habe ich jetzt noch das Problem, dass mir der Sprit ausgeht. In Baska gibt es nämlich keine Tankstelle und damit habe ich nicht gerechnet. Jeden Moment erwarte ich, dass ich auf Reserve schalten muss – und ich habe noch den Pass vor mir und etliche Kilometer. Glücklicherweise habe ich einen Reservekanister mit 1,8 Litern Sprit dabei, doch das Einfüllen ist mühsam und ich bin eh schon fix und foxi.
Doch ich schaffe es bis zur Tankstelle und somit auch nach Krk. Im ersten Hotel, das ich finde, gibt es eine nette, junge Rezeptionistin namens Veronika, die aber leider auch kein Zimmer für mich hat. Als ich ihr erzähle, dass ich eigentlich keine Kraft mehr habe um alles abzusuchen, erbarmt sie sich meiner und ruft die anderen 3-4 Hotels an. Leider ohne Erfolg, sie meint, in Krk würde ich nichts mehr finden, vielleicht in Malinska, ca. 15 km von hier.
Ich bin kaputt und beschließe von der Hotellobby in Malinska anzurufen. Das erste ist das Hotel Adria, wo ein netter Herr abhebt und tatsächlich meint, er hätte noch ein Zimmer. Es würde 75 Euro kosten und ein Motorradparkplatz direkt vor dem Haus wäre auch dabei.
Ich beschließe, ihm sofort um den Hals zu fallen und starte schnellstens die Vespa, obwohl er meint, dass er mir das Zimmer gerne reservieren kann.
In Malinska angekommen fällt mir ein Stein vom Herzen. Endlich ein Zimmer, endlich ein Bett, eine Dusche – herrlich! Und das mit dem Parkplatz stimmt auch, sogar Free WLAN gibt es.

Nach einer kurzen Ruhepause mache ich einen Spaziergang, kaufe eine Flasche Wasser und gehe am Strand schwimmen. Es gibt in Malinska eine kleine Marina, alles wirkt ausgesprochen sauber und die Strandpromenade ist sehr durchdacht angelegt. Es ist trotzdem kein Ort, an dem ich eine Woche Urlaub verbringen möchte – zu neckermännisch ist hier alles.

Außer der Ausstellung direkt an der Promenade. Über 60 große Tafeln, auf denen historische Fotos von 1900 bis 1930 zu sehen sind, alle aus Kroatien und eine wirklich interessante Zeitdokumentation.
Die Promenade ist gut gefüllt, vor allem viele Familien sind zu sehen, die noch einen Abendspaziergang machen. Ich bin wirklich erleichtert und bekomme schön langsam Hunger. Ich habe mich schon seit Wien auf das gute kroatische Essen gefreut und daher wähle ich gleich das Hotel-Restaurant. Man sitzt im Freien und die Pleskjavica schmecken hervorragend.

Ich lasse den Abend ruhig ausklingen, surfe noch ein wenig auf Facebook und lege mich dann schlafen.

In der Nacht bekomme ich Durst und habe leider kein Wasser mehr. Aus dem Wasserhahn kommt sehr kaltes, klares Wasser und ich riskiere es, davon zu trinken. Wird schon gut gehen.
FREITAG
Ich weiß zwar nicht warum, aber ich bekomme kein Frühstück runter, nicht einmal ein Stück Marmeladebrot. Das Reisefieber müsste eigentlich schon weg sein, aber ich habe nicht sehr gut geschlafen. Es war drückend heiß und ich fühle mich nicht allzu toll. Auschecken, Vespa satteln und ab geht es nach Rijeka, wo ich das zweite Ziel meiner Reise erreichen möchte: das Grab von Albert Kudlicka.
Die Fahrt geht zügig voran, die Vespa läuft problemlos und die Rückfahrt über die Brücke ist erstaunlicherweise mautfrei.
Im Zentrum von Rijeka, das übrigens architektonisch durchaus reizvoll ist, im Gegensatz zum Hafen und den Betonsilos rundherum, aktiviere ich das erste Mal mein Navi, damit es mich zur Straße namens „Petra Kotalka“ führt, wo der Eingang zum Friedhof ist – im STadtteil Kozala, ziemlich weit oben am Berg und direkt unterhalb der Autobahn. Ein guter Hinweis (Danke an Rainer Derx) ist das T-Mobile-Hochhaus, weil sich direkt daneben der Friedhofseingang befindet.
Mit nur einmal falsch fahren finde ich den Eingang und stelle die Vespa ab. Es ist bereits enorm heiß und ich hoffe im dort befindlichen Blumengeschäft Hilfe zu bekommen. Die jüngere der beiden Verkäuferinnen spricht Englisch und erklärt sich sofort und sehr freundlich bereit meinen Helm und den Nierengurt für mich aufzubewahren und einen Blick auf die Vespa zu werfen.

Ich kaufe eine große Kerze und bekomme von ihr noch Zündhölzer, dann mache ich mich auf den Weg Rainer war ca. drei Wochen vorher schon dort und hat eine genaue Fotodokumentation vom richtigen Weg zum Grab gemacht – das ist jetzt ausgesprochen hilfreich.
Nach wenigen Minuten stehe ich am Grab und habe mein zweites Reiseziel erreicht.

Der Friedhof ist sehr schön und ruhig, man hört gar nichts von der benachbarten Autobahn. Alles ist sehr grün und gepflegt. Das Grab vom alten Kudlicka ist klassisch angelegt und passt zu den anderen Gräbern. Nur eine Sache stimmt halt überhaupt nicht. Ein Steinmetz hat in eine Platte einen Roller eingraviert. Was genau passiert ist, kann ich nicht sagen (und muss Sergio bei Gelegenheit danach fragen), aber statt einer Vespa ist eine Lambretta eingraviert. Irgendwie ist das so als würde man am Grabstein von Enzo Ferrari einen Maserati eingravieren.

Eigentlich sollte man die Platte austauschen. Aber das wäre eine größer angelegte Aktion. Ich zünde noch die Kerze an und mache mich dann wieder auf den Weg. Heute habe ich glücklicherweise keinen so weiten Weg. Ich muss nur noch durch Rijeka durchfahren und dann an der kroatischen Riviera entlang durch die Orte Opatija, Lovran und Medveja nach Mosenicka Draga, meinem dritten Reiseziel.
An Hochhäusern vorbei fahre ich hinunter zur Hafenstraße und dann quäle ich mich durch den dichten Verkehr an der kleinen Küstenstraße. Mit der Vespa komme ich jedoch gut voran, weil ich überall überholen und mich vorbeischlängeln kann.
In Medveja bleibe ich kurz stehen und sehe mir die Villa Susmel an. Sie ist wunderschön hergerichtet und der neue Besitzer dürfte sie gut pflegen.
Hier ist das Geld daheim, das sieht man auf den ersten Blick. Nur 50 Meter weiter befindet sich die Villa vom Albert Kudlicka – das habe ich seinerzeit, als wir öfter in der Villa Susmel waren, natürlich nicht gewusst.
Ich starte die Vespa und fahre nach Mosenicka Draga. Dort versuche ich in einem dieser zahlreichen Touristenbüros, die es auch hier wie Sand am Meer gibt, ein Zimmer zu bekommen. Sergio meinte lakonisch, dass das überhaupt kein Problem wäre, es gäbe viele Pensionen und er würde auch alle Leute hier kennen.
Leider hat er nicht bedacht, dass ich alleine bin und maximal drei Tage bleibe. Der nette junge Mann im Tourismusbüro meint, dass ich doch um 17 Uhr noch einmal kommen solle, vielleicht könnte er mir dann ein Quartier beschaffen.
Mir ist das nach meinen Erlebnissen in Baska viel zu unsicher und so fahre ich in den Ortskern, wo es zwei Hotels gibt. Im ersten empfängt mich die hübsche Rezeptionistin zwar mit freundlichen Worten, meint aber nach einem Blick in den Computer, dass sie auch kein Zimmer für mich hätte.
Geht das jetzt wieder los? Das kann doch nicht wahr sein!
Nach Rücksprache mit dem Chef sieht sie eine gewisse Chance und bittet mich noch ein wenig zu warten. Man müsse nur ein wenig disponieren und dann könnte ich eventuell ein Zimmer bekommen.
Ich warte draußen und passe auf die Vespa auf, denn angeblich kommt nach spätestens 20 Minuten ein Polizist und dann muss man wegfahren.
Vorher kommt aber noch die Rezeptionistin und berichtet mir freudig, dass ich das Zimmer hätte, nur könnte ich es erst um 14 Uhr beziehen. Aber mein Gepäck könnte ich trotzdem da lassen.
Ich habe vorher schon mit Sergio telefoniert, der sich bereits am Strand von Medveja befindet (warum auch immer dort und nicht hier in seinem Ort) und meinte, ich solle doch gleich zum Strand fahren, sie hätten einen guten Schluck zu trinken dort.
Ich erfahre von der Rezeptionistin, dass sie noch einmal umdisponiert hätten und ich das Zimmer jetzt gleich haben könnte. Mir ist inzwischen alles recht, ich werde nie durchschauen, was da in Kroatien zimmermäßig wirklich abgeht. Jetzt fahre ich einmal hinüber nach Medveja, aber ohne das ganze Gepäck.
Am Strand angekommen finde ich Sergio nicht. Ein kurzes Telefonat klärt, dass er sich auf der anderen Seite der Bucht befindet, die glücklicherweise nicht sehr groß ist.
Dann habe ich ihn gefunden, und seine Kumpels gleich mit dazu und außerdem noch seine Sohn Sebastian mit dessen Freundin und Adriana, die Tochter vom alten Kudlicka und Frau von Sergio.
Sie sind hier alle entweder aufgewachsen oder seit Ewigkeiten Stammgäste. Adriana und Sergio beginnen sofort einen kleinen Streit darüber, ob ich gleich ein Bier trinken muss oder vorher noch einen gespritzen Apfelsaft trinken darf. Adriana gewinnt und ich bekomme meinen Saft.

Danach gönne ich mir auch noch eine Erfrischung im Meer und fange dann langsam an mich zu entspannen, also zumindest bis zum Bier, das Sergio mir unter reger Anteilnahme seiner Kumpanis blitzschnell organisiert hat. Ich mag Bier, aber wenn ich an dem Tag noch nichts gegessen habe, es erst früher Nachmittag ist und die Sonne runterknallt, ist das nur eine mäßig gute Idee.
Das interessiert Sergio aber genau original gar nicht und so kippe ich mir das Bier hinein. Darminfektion, Stress, ein heißer Tag – das könnte sich noch zu einer Herausforderung auswachsen.
Generell ist die Lage jedoch sehr entspannt. Die Vespa hat ohne Probleme gehalten, ich habe ein teures, aber gutes Quartier und frage mich, ob ich die geplanten weiteren zwei Tage noch hier bleiben werde. Adriana meint, dass leider für den nächsten oder übernächsten Tag schwere Unwetter angesagt seien, die nach der wochenlangen Hitze und Trockenheit auch ein klein wenig heftig ausfallen könnten. Ich schiebe diese Probleme weg und trinke das nächste Bier.
Dann überkommt mich ein Anfall von Nostalgie und ich marschiere nach vorne zum Kap, das die Bucht auf der linken Seite begrenzt. Dort thront über allem die Villa Susmel. Herunten auf der Mole gibt es ein Lokal und ich finde den Einstieg wieder, von dem aus wir vor über zwanzig Jahren unseren Silvestertauchgang absolviert haben. Das hat sich nicht merklich verändert und doch wird mir langsam klar, wie lange das alles schon zurück liegt.

Damals hatte niemand oder fast niemand meiner Freunde schon Kinder, das Leben war wirklich unbeschwert und wir verbrachten einige schöne Wochenenden hier in Istrien. Jetzt bin ich alleine hier und denke an die alten Zeiten.
Danach marschiere ich zurück zur lustigen Runde und verbringe noch eine Zeit mit ihnen, bevor ich nach Mosenicka Draga zurück fahre. Als es Abend wird, folge ich dem Tipp von Thomas aus der lustigen Runde und finde das von ihm angepriesene Lokal. Leider gilt auch hier das gleiche wie bei den Zimmern: wer alleine unterwegs ist, hat Pech gehabt.
Doch eine nette Kellnerin findet einen kleinen Tisch für mich und ich bestelle Calamari und ein gutes Bier. Ich freue mich auch schon sehr auf die Palatschinken und erinnere mich, wie gut die damals in den 1990ern waren – und wie billig. Damals war der Tourismus nach dem Balkankrieg gerade erst wieder im Aufschwung, alles war günstiger und irgendwie gemütlicher. Jetzt blinkt einem an jeder Ecke der Kommerzgötze entgegen, alles ist mit Schranken abgesperrt bzw. sonstwie gegen freie Benützung gesichert. Der Zauber des Ortes ist verschwunden oder zumindest zurück gegangen.
Auch bei mir verschwindet der Zauber und die Palatschinken schmecken irgendwie gar nicht mehr gut. Ich merke, wie sich Magen und Darm gar nicht wohl fühlen und marschiere schnell zum Hotel zurück, das glücklicherweise nicht weit weg ist. Da der Supermarkt bis 22 Uhr offen hat und am nächsten Tag ein Feiertag ist, kaufe ich noch eine große Wasserflasche.
Mein morgiger Plan besteht darin mit dem Bus nach Opatija zu fahren und dann den „Lungomare“ zu marschieren, die wunderschöne und berühmte Strandpromenade. Am Nachmittag würde ich dann wieder der lustigen Runde am Strand Gesellschaft leisten und wahrscheinlich am Tag darauf – also am Sonntag – nach Klagenfurt fahren, um meinen alten Freund Rudi zu besuchen.
Im Hotel zieht es mich zuerst auf´s WC und dann merke ich, dass es mir irgendwie gar nicht so gut geht. Die Belastungen der letzten Tage holen mich ein und mir wird auch klar, dass das Wasser im Hotel von Malinska gar nicht gut gewesen sein dürfte. Ich nenne es „Titos Rache“ (als Pendant zu Montezumas Rache) und befürchte, dass das bis zum nächsten Tag wohl nicht wieder verschwunden sein würde.
Dann gibt mir der Wetterbericht den Rest. Angesagt ist in Inferno oder noch schlimmer, und zwar für die nächsten vier Tage, von Slowenien über Kärnten bis Wien.
Das schmeißt all meine Pläne auf einen Sitz über den Haufen, denn eines ist klar: ich will und werde nicht im Regen quer durch Slowenien und Österreich fahren, ganz sicher nicht.
Der nächste Tag verspricht noch Sonnenschein und ich überlege, was ich tun soll: hier bleiben, auf die Gefahr hin, dass es mich mehrere Tage einregnet und ich alleine in einem kleinen Hotelzimmer sitze – oder eine Gewalttour von hier direkt nach Wien unternehmen. Ich habe die Wahl. Das würde allerdings bedeuten die Autobahn zu wählen, was ich echt nicht gerne mache. Als Vespafahrer bist du genau in der Geschwindigkeit der LKW und das für viele viele Stunden.
Ich beschließe den Sonnenaufgang abzuwarten, aber eigentlich habe ich den Entschluss schon gefasst. Die Nacht wird trotzdem nicht angenehm und kurz vor dem Morgengrauen graut nicht nur wieder einmal meinem Magen, sondern es fängt auch leicht zu regnen an.
Doch der Regen dauert nur wenige Minuten und wirkt etwas später, als hätte es ihn nie gegeben.
SAMSTAG
Als die Sonne aufgeht packe ich meine Sachen und marschiere zur Rezeption. Wenn sie mir jetzt zwei Nächte verrechnen, habe ich Pech gehabt. Mich beutelt leichter Schüttelfrost, die Knie sind weich und ich habe ganz sicher keine Kraft um zu streiten. Doch es geht alles gut, ich zahle eine Nacht und haue ab.
Als ich auf der Vespa sitze, fällt wieder etwas von dem Druck ab, den ich mir gemacht habe. Der Morgen ist wunderschön, die Wolken haben sich verzogen und es fängt sogar jetzt um 06.30 Uhr bereits an warm zu werden. Irgendwo in Lovran überholt mich dann ein Wiener PKW und irgendwie habe ich den Verdacht, der Fahrer will was von mir. Er blinkt auffällig links und biegt dann vor mir ab. Ich fahre einfach weiter, schließlich kenne ich hier niemanden und bin mir auch sicher, dass ich nichts verloren habe. Das Gepäck ist jedenfalls noch da. (Viel später erfahre ich, dass das Sergio war, der für mich völlig unerwartet schon so früh auf den Beinen war…)
Ich fahre hinauf in die Berge und wähle die Landstraße bis zur Grenze, die ich teilweise ja schon hinunter gefahren war. Dann bin ich wieder in Slowenien und nehme wie immer die Abkürzung über Knezak. Es ist interessant wie anders eine Strecke aussieht, wenn man sie in der Gegenrichtung fährt.
In Knezak geht der Sprit zur Neige und ich finde glücklicherweise eine Tankstelle im Ort. Und dazu auch das passende Örtchen, denn mein Darm meldet sich zur Stelle.
Danach geht es zügig nach Postojna, wo die Autobahn beginnt. Die slowenische Autobahnvignette kostet 7,50 Euro (die österr. übrigens 5 Euro) und ist an einer Tankstelle zu haben.
Das Wetter ist gut und ich hege berechtigte Hoffnung ohne Regen bis nach Wien zu kommen. Wie wird sich die Sprint auf der Autobahn machen? Ich bin noch nie so eine lange Strecke gefahren und bin schon gespannt.
Mein Glück: Heute ist Feiertag und es sind keine LKW unterwegs. Die wären tempomäßig nämlich genau in meiner Preisklasse und ihre Abwesenheit erleichtert mir die Sache ungemein. Ganz im Gegensatz zu meinem Genick, das eigentlich keine schmerzfreie Position mehr kennt. Ich mache alle paar Minuten die wildesten Verrenkungen, um die Muskeln irgendwie zu entspannen, aber das hilft immer nur für ein paar Momente.
Auch der Hintern fängt an weh zu tun, obwohl die Sitzbank ihr Bestes gibt. Ich wechsle die Sitzposition von ganz vorne bis ganz hinten – für die Autofahrer muss das ein lustiges Bild abgegeben haben, ich fand es weniger aufregend.
Doch die Zeit verging und ich erreichte Laibach, bekam von der Stadt aber maximal ihre Stadtautobahn mit. Es gibt in regelmäßigen Abständen Mautkontrollstationen, bei denen man aber nur die Geschwindigkeit ein wenig drosseln muss. Also die Autos müssen sie drosseln, ich bin schon langsam. Genau genommen bin ich der Langsamste überhaupt. Ich werde auf der gesamten Autobahnstrecke ununterbrochen überholt, und zwar von allem, was dort fährt. Besonders mühsam sind die Italiener mir Lieferwägen. Die schneiden vor mir so dicht hinein, dass es mich jedes Mal einen halben Meter versetzt. Warum sie sich da so verschätzen bleibt mir ein Rätsel.
Irgendwann überholt mich eine Gruppe tschechischer Motorradfahrer. jeder von ihnen streckt nach dem Überholen kurz den rechten Fuß nach rechts hinaus. Ich entwickle drei Theorien, was sie mir damit sagen wollen:
a.) Du miese Ratte, an der nächsten Tankstelle treten wir dich von deiner Dose.
b.) Sei gegrüßt!
c.) Lässiges Moped, gute Fahrt!
Ich entscheide mich für Variante c.) und fahre meinen Stiefel weiter, und zwar bis Celje, dort muss ich tanken. Die Straße ist hier nass, vor kurzem muss es ordentlich geregnet haben, obwohl keine wirklich bedrohlichen Wolken zu sehen sind und der Himmel schon wieder blau schimmert.
Ich beschließe einfach weiterzufahren und komme endlich wieder nach Österreich. Jetzt sind es noch ca. 230 km bis Wien, das ist schon noch ein ordentliches Stück. Aber es geht gut voran, bis auf die körperlichen Schmerzen bin ich guter Dinge und das Wetter dürfte auch halten.
Bei Graz wird es wieder Zeit auf den Sprit zu achten. Ich merke, dass ich noch immer nicht auf Reserve schalten musste und daher noch eine gute Zahl an Kilometern weit komme. Die Raststätte Gleisdorf ist gerade mal 15 km entfernt, das geht sich locker aus.
Allerdings sehe ich es nicht mehr ganz so locker als ich entdecke, dass ich nach dem letzten Tankvorgang den Hebel auf Reserve gelassen habe. Das könnte jetzt eng werden, niemals jedoch tragisch, da ich ja den Reservekanister dabei habe.
Als ich die Raststätte dann erreiche, sieht man im Tank schon die Befestigungsmutter des Benzinhahns frei liegen. Echt weit wäre ich nicht mehr gekommen.
Wirklich interessant ist für mich die Politik der Autobahnsteigungen. Sie dürfte einem internationalen Vereinbarung unterliegen und sie sind alle so flach, dass ich vom vierten Gang nicht zurück schalten muss. Das ist ausgesprochen angenehm und so überwinde ich auch die letzte große Steigung am Wechsel. Bergab gönne ich mir dann die letzte Pause, mit einem Apfel und einem guten Schluck Wasser. Die Chancen, pannenfrei bis nach Wien zu kommen, steigen beständig.
Am folgenden Bild mache ich gerade die letzte Rast vor Wien, im Hintergrund ist der Wechsel zu sehen.

Ab Wr. Neustadt bin ich in „Rettungsreichweite“, d.h. es gibt diverse Vespa-Freunde, die mich von dort abholen können, wenn die Kiste eingeht. Es sieht aber nicht danach aus, der Motor schnurrt und – was sehr angenehm ist – saftelt auch nicht.
Auf der Triester Straße wird noch einmal getankt, dann geht es über den Gürtel nach Hause. Immerhin 8 Stunden Fahrzeit, denn die Pausen waren kurz und haben sich mehr oder weniger auf´s Tanken beschränkt.
FAZIT
Eine ausgesprochen anstrengende Tour, die ich so nicht mehr machen möchte, geprägt von Durchfall und Genickschmerzen. Trotzdem werden nach einiger Zeit die schönen Erinnerungen dominieren und ich habe letztlich auch mit dem Motor die richtige Entscheidung getroffen. Im Gegensatz zur Romreise bin ich ohne die kleinste Panne durchgekommen, wenngleich es auch nur halb so viele gefahrene Kilometer waren. Das bringt mich zur Statistik:
Gefahrene Kilometer: 1.328
Verfahrenes Benzin: 55 Liter (Schnitt 4,14 auf 100 km)
Gesamtkosten: 300 Euro