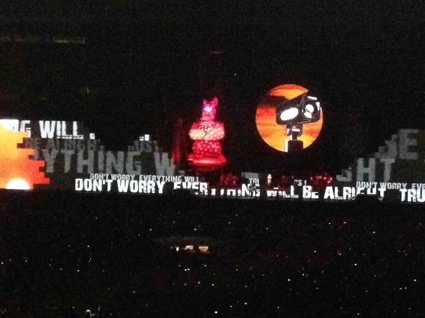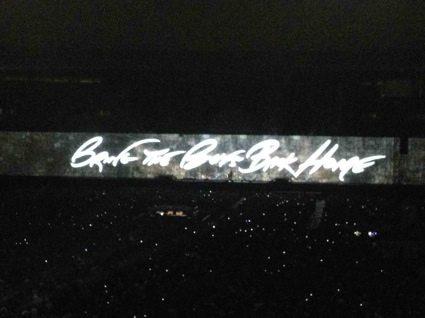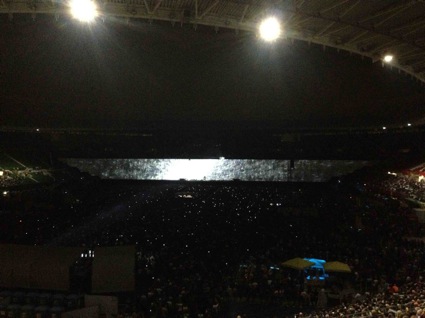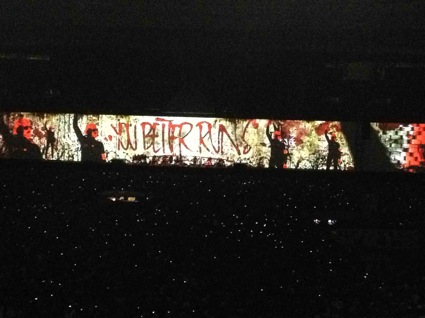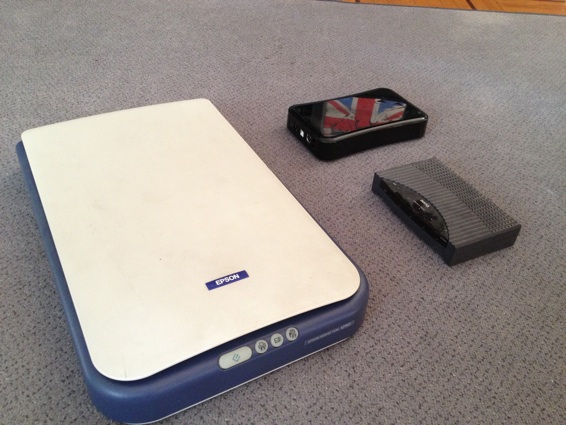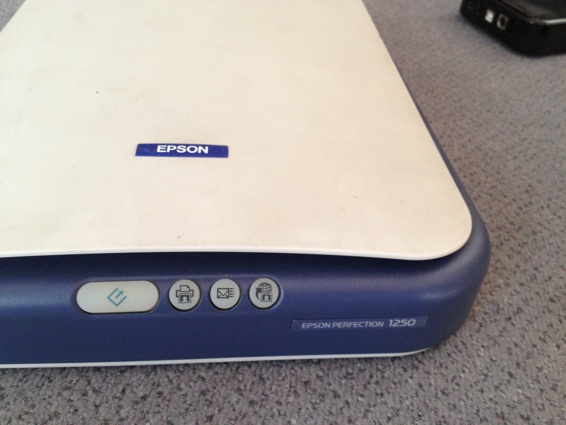Unmengen an Infos, Phantasien, Geraunze und Gejammere rund um den Umbau von Wiens wichtigster Einkaufsstraße. Was ist wirklich dran? Um das herauszufinden, habe ich mich selbst in die Höhle des Löwen geschickt, quasi mit vollem Risiko. Meine erste echte, gefährliche Fact-Finding-Mission, im Auftrag der Grünen Wirtschaft. Ich komme mir vor wie wenn ich nach Mogadischu müsste, um dort von einem blutigen Bürgerkrieg zu berichten.
Die Mariahilferstraße als Fußgängerzone – laut Medienberichten reinste Anarchie, wildes Chaos und der Untergang des Abendlandes.
Also setze ich meinen Helm auf, ziehe die Protektoren-Mountainbikehandschuhe an und begebe mich an den Ort des Schreckens.

Der zeigt sich auf den ersten Blick eher friedlich, aber vielleicht ist das nur die Ruhe vor dem Sturm, wer weiß?
Auf zahlreichen Schildern wird aufgeklärt, dass die markierten Zonen keine Parkplätze wären, sondern Halte- und Parkverbot zu beachten seien.


Allein die scheinbare Notwendigkeit dieser Schilder plus die wenigen, aber doch vorhandenen herumirrenden und sichtlich verwirrten Autofahrer mit NÖ-Kennzeichen zeigt sehr gut, dass Veränderungen punkto ihrer Akzeptanz Zeit brauchen. Die Mariahilferstraße war Jahrzehnte lang eine reine Einkaufsmeile und soll jetzt ihre Charakteristik vollständig verändern.
Dass das nicht in ein oder zwei Tagen vollständig gelingen kann, sollte auch den eher schlichten Gemütern einleuchten. Derzeit gibt es in den Medien und auch im „Social-Media-Bereich“ erhitzte Gemüter, viel heiße Luft und ein Mords-Trara, wie der Wiener sagt.
Ich fahre die Mariahilferstraße zur Mittagszeit ca. 1,5 Stunden lang ab, plaudere mit Passanten und Mitarbeitern der MA 28 und nehme mir Zeit um die Stimmung aufzunehmen.

Die Eindrücke sind vielfältig und ich greife den wichtigsten heraus: Die Charakteristik hat sich schlagartig verändert. Ich bin die Straße in den letzten Jahren mit Fahrrad und Motorroller oft entlang gefahren, heute war es radikal anders.
Zuerst wusste ich nicht, was da so seltsam war, dann fiel mir auf, dass sich die Geräuschkulisse vollständig verändert hat. Es war teilweise fast gespenstisch leise, und das lag nicht an den dort einkaufenden und spazierenden Menschen, sondern einzig und allein am fehlenden Autoverkehr. Hin und wieder fuhr ein Klein-LKW durch oder ein Taxi, aber kein Vergleich mit früher.
Es war als würde die Straße warten, nur worauf? Vielleicht auf eine Art Wiedergeburt als Lebensstraße, als ein Ort, an dem man sich gerne aufhält und nicht nur von einem Geschäft zum anderen hetzt. Dafür war die alte Mariahilferstraße optimiert und auch durchaus optimal, mit Kurzparkzonen, die einen hohen KFZ-Umsatz erzeugten.
Jetzt ist das anders, sehr anders sogar. Die Autos wirken bereits wie Fremdkörper, wenngleich die Fahrbahnen immer noch frei von Fußgängern sind, als würden sie die Rückkehr der Autos erhoffen. Oder befürchten.

Dass die FußgängerInnen die ehemaligen Fahrbahnen noch nicht in Besitz nehmen, hat meiner Ansicht nach mehrere Gründe:
a.) Das dauert. Jahrzehntelang angelerntes Verhalten ändert sich nicht von einem Moment auf den anderen. Ehrfurcht und Angst vor den tonnenschweren Blechkisten und ihren darin von der Umwelt abgeschotteten (Klimaanlage, getönte Scheiben, Geräuschdämmung etc.) Besitzern lassen sich nicht so schnell abschütteln.

b.) Die vorhandenen baulichen Trennungen. Sie sind ja nach wie vor existent und verstärken Punkt a.) Die Fahrbahnen sehen aus wie Fahrbahnen und werden daher nur von RadfahrerInnen benützt. Die haben dafür Platz wie noch nie und nützen den auch für erhöhtes Tempo aus – natürlich nicht alle, aber auch mich hat es gereizt in die Pedale zu treten, so ohne störende Autos und LKW und Ampeln. Das ist ein weiterer Grund für die FußgängerInnen, die ehemalige Fahrbahn nicht in Längsrichtung zu benützen und in Querrichtung laut angelerntem Verhalten zu warten und Sicherungsblicke in beide Seiten zu werfen.

Ich schätze, dass sich bei mehr Betrieb langsam eine Veränderung einstellen wird. Die Gehsteige waren in der Vergangenheit schon recht dicht begangen, das könnte sich auflockern, vor allem wenn sich die Gesamtcharakteristik ändert und die Menschen länger dort verweilen. Die neu gepflanzten Bäume würden das zusätzlich und gemeinsam mit den nett gestalteten Sitzgruppen fördern. Wenn dann noch die geplanten baulichen Entwicklungen abgeschlossen sind, wird sich das Antlitz der Straße massiv verändert haben. Ich bin durchaus gespannt, welche Art von Lebensraum hier entsteht.
c.) Die Busse. Sie sind groß und rot und fahren zwar langsam, aber sie fahren und da traut sich niemand so einfach auf die Fahrbahn (nein, es ist keine mehr, aber es ist eben schon noch eine) zu hüpfen.
Die Busfahrer selbst fahren langsam, aber sie steigen immer wieder mal so ganz leicht aufs Gas, fast unmerklich, aber doch spürbar. Drücken sie damit ihren Unwillen aus, trotz freier Straße nicht ordentlich und in entsprechender Geschwindigkeit fahren zu können? Vielleicht hat das auch ganz andere Gründe, aber die Straße ist nun mal so herrlich frei und sie haben so wunderbar viele PS unterm Hintern… Menschen sind schwach, Busfahrer sind auch nur Menschen.
Ein knallig roter Streifen verstärkt das noch: Das ist mein Revier und ich bin groß und stark oder zumindest stärker als Du!

Möglicherweise war dieser rote Streifen keine sehr gute Idee. Vielleicht war er auch eine wirklich schlechte, ich jedenfalls weiß nicht, wie das zustande gekommen ist. Angeblich wird schon eine neue Routenwahl überlegt.
Die vielbeschworenen platt gefahrenen Fußgänger habe ich heute nicht gesehen und der nette junge Mann von der MA 28 hat mir auch versichert, dass es sie (noch) gar nicht gibt. Genau genommen will das auch keiner, außer vielleicht die oppositionsnahe Boulevard-Presse, die dringend Stoff gegen die Mariahilferstraße bzw. ihren Umbau braucht.
Ich stelle mir gerade vor, welche Grausbirnen manchen Politikern aufsteigen würden, wenn sich das neue Konzept bewährt. Das könnte dann sogar abfärben, vielleicht will dann die Währinger Straße auch FuZo werden, oder gar die Lerchenfelderstraße, oder die Taborstraße oder oder oder…
Schweißgebadet wachen sie vielleicht heute schon aus ihren Alpträumen auf, wer weiß.
Ich bleibe beim aktuellen Thema und fahre langsam weiter. Die Schanigärten sind voll und auch sonst herrscht in etwa das übliche Treiben. Scheinbar haben die Geschäfte noch keine schlimmen Rückgänge zu verzeichnen und möglicherweise löst sich das von Frau Präsidentin Jank gezeichnete Schreckgespenst ja auch in Luft auf.
Einige Ampeln sind inzwischen außer Betrieb, das dürfte aber niemand stören. Erst nach einiger Zeit fällt mir auf, dass es keine Zebrastreifen mehr gibt.

Auch das funktioniert erstaunlich gut und ich beginne mich zu fragen, ob wir diese starken Regulierungen wirklich immer und überall brauchen. Muss jeder Meter vorgezeichnet sein? Bei den Radstreifen in ganz Wien ist mir das bis heute unklar, was die bringen sollen, außer dass die motorisierten ZweiradfahrerInnen daran gehindert werden rechts an den stehenden Kolonnen vorbei zu fahren. Das ist für mich übrigens keine sehr grüne Lösung, die maximal die Autofahrer freut.
Nun entsteht möglicherweise der eigentliche Kern des Konzepts: Die Menschen beginnen zu lernen, dass es wesentlich besser funktioniert, wenn man das tut, was jeder Fahrschüler in der ersten Stunde lernt: Kontakt mit anderen aufnehmen, Blickkontakt nämlich. Wer sich sieht, fährt normalerweise nicht zusammen. Das gilt für Radfahrer wie für Fußgänger wie für Autofahrer. Und alle –innen natürlich auch.
Die Autoindustrie macht es den Autofahrern hier schwer, Stichwort die schon erwähnte Abschottung nach außen. Wenn die Umwelt nur noch Kulisse zu sein scheint, wozu soll ich mit ihr Kontakt aufnehmen? Wenn die Personen draußen wie ein Videospiel erscheinen, wozu soll ich auf sie Rücksicht nehmen?
Auf der neuen Mariahilferstraße kann man jetzt entdecken, wie das anders funktionieren kann. Jetzt kann das Recht auf Vorfahrt der Verhandlung weichen. Ich lasse dich fahren und an der nächsten Kreuzung lässt jemand anderer mich fahren – eine ganz neue Erfahrung in einem vielleicht schon sehr überreglementierten Verkehr. Jeder Blickkontakt ist eine Begegnung, wenn auch nicht der dritten Art. Vielleicht ist das ja der tiefere Gedanke einer „Begegnungszone“. So könnte ja auch ein Aufreißerlokal heißen und vielleicht entwickelt sich die Mariahilferstraße ja auch noch in diese Richtung. Die Schanigärten werden wahrscheinlich wachsen und noch mehr Menschen anlocken, weil man jetzt genügend Platz zum Flanieren hat.
Die Begegnungszonen sind jedenfalls ausreichend beschildert, wer das nicht sieht, will es nicht sehen.

Ganz wichtig sind dabei die Sitzzonen, von denen es ja schon ein paar gibt. Sie waren heute schon gut gebucht und die Lokale werden sich damit anfreunden müssen, dass es sie gibt und dass die Menschen dort sitzen können ohne etwas konsumieren zu müssen.
Das Museumsquartier hat es vorgezeigt, dass hier ein Miteinander durchaus möglich ist. Dort gibt es freie Sitzmöglichkeiten und Lokale – beide können existieren, ohne den jeweils anderen Bereich zu stören.

Das schlimme und menschenverachtende Gegenteil dieses Konzepts kann man seit ein paar Jahren zunehmend in Bahnhöfen beobachten, wo die letzten Sitzgelegenheiten demontiert werden, damit die Menschen gezwungen sind, ihre Wartezeit in einem Lokal plus Konsum zu verbringen.
Die Freiräume könnten die Straße zu einem sehr lebenswerten Raum machen, der aus der ganzen Stadt Menschen anzieht.
Wahrscheinlich werden diese Menschen auch auf die Idee kommen die zahlreichen Geschäfte zu besuchen. So kann es durchaus zu einer Umsatzsteigerung kommen. Vielleicht werden nicht alle Geschäfte überleben, das ist durchaus denkbar. Aber das hätten sie ohne den Umbau möglicherweise auch nicht getan.
Es ist nicht alles eitel Wonne, das darf nicht verschwiegen werden. Es wird zu Konflikten zwischen Radfahrern und Fußgängern kommen, das ist anzunehmen. Hier wird man eventuell nachbessern müssen. Es war heute schon so, dass die Radfahrer ganz bewusst oder auch instinktiv die Mitte der Straße gewählt haben. Sie werden auch in Zukunft nicht mitten durch die Menschenmassen fahren, allein schon deswegen, weil das gar nicht geht. Sie legen auch Wert auf eigene körperliche Unversehrtheit und die geht beim Radfahren nun einmal Hand in Hand mit der Unversehrtheit der anderen. Bei einem Zusammenstoß gewinnen beide nicht, ganz im Gegenteil zum Auto, wo der Sieger immer vorher schon feststeht.
Inmitten der Menge kann man das Rad nur schieben, kein Mensch kann so langsam durchfahren. Also werden die Radfahrer tendenziell getrennt von den Fußgängermengen bleiben und auch die Fußgänger werden sich daran gewöhnen, dass in der Mitte viele Radfahrer schneller unterwegs sind. Es wird immer Raser geben, aber die gab es bisher auch schon. Und es mag durchaus sein, dass sie die Lust am Rasen verlieren werden.
Die Lösung mit den verhinderten Querungen ist vielleicht auch nicht wirklich durchdacht. Besonders provokant wirkt sie bei der Kreuzung mit der Schottenfeldgasse. Da konnte man von oben nach unten queren, jetzt muss man links abbiegen und wird in eine Einbahnspirale gelotst. Das hat schon manchen Autofahrer zur Verzweiflung gebracht und ich halte das für eine mäßig brauchbare Pädagogik.

Drei bis vier Querungen würden nicht weh tun, auch nicht dem grünen Gedanken. Selbstverständlich bräuchte es dazu bauliche Maßnahmen wie gute Schwellen, um die Autofahrer am Durchrasen zu hindern. Für mich wäre eine Lösung ohne Ampeln und auch ohne Zebrastreifen durchaus sinnvoll. Man würde eben eine ganz spezielle Zone durchqueren und hätte darauf Rücksicht zu nehmen. Die Botschaft könnte eine friedliche sein: „Werter Autofahrer, wir wollen dir dein Recht auf Durchfahrt nicht nehmen. Nimm Du uns dafür nicht unser Recht auf eine beruhigte Zone. Danke!“
Das wäre ein anderes Signal als Einbahnschnecken und Behinderungslösungen.
Aus meiner Sicht sollte es nach drei Monaten eine ehrliche Evaluierung und daran anschließend Nachbesserungen geben. Und nach sechs Monaten noch einmal. Und dann noch einmal nach einem weiteren Jahr.
Und ich glaube nicht, dass man sich um die Wirtschaft Sorgen machen muss, da sieht es in anderen Straßen Wiens wesentlich trauriger aus. Es wird vielleicht sogar dringende Initiativen geben müssen um andere sterbende Straßen wiederzubeleben, weil die Mariahilferstraße eventuell zu einem noch stärkeren Magneten wird. Das wird die Aufgabe der Politik sein, die möglicherweise auch die etwas zahnlos und hilflos wirkenden Wiener Einkaufsstraßen neu definieren muss.
Ich persönlich finde den Anfang durchaus vielversprechend und empfehle allen, die jetzt schon wissen, dass das niemals funktionieren kann und wird, einfach einen Besuch auf dieser wirklich neuen Straße. Oder wie ein alter Kabarettist gemeint hat: Schau´n Sie sich das an!
So eine Geburt erlebt man nicht alle Tage! Und das Eis beim Bortolotti schmeckt immer noch ganz gut.

UPDATE 3 WOCHEN SPÄTER: Ein Haus ohne Dach
Es sind nur drei Wochen, aber es zeichnet sich bereits ab was gut funktioniert und was nicht:
1.) Schwer einschätzbar ist das Geraunze der Wirtschaftskammer, die als Fast-Monopolbetrieb des ÖVP-Wirtschaftsbundes natürlich Wahlkampf betreibt und ständig unzufriedene Gewerbetreibende hervorzaubert, die mit unpassenden Ausdrücken („Berliner Mauer“) Agitation betreiben. Das ist deswegen unangenehm, weil dadurch die berechtigten Anliegen und Schwachstellen nicht konstruktiv diskutiert werden können – Emotion siegt.
Es wird auch klar, dass die Planer auf die Interessen der Gewerbetreibenden nicht ausreichend Rücksicht genommen haben.
2.) Die elende Diskussion um die Querungen. Die Grünen rechtfertigen sich damit, dass das rote Mariahilf und das grüne Neubau sich nicht auf ein gemeinsames Konzept einigen konnten. Und dass man doch die Schleichwege verhindern wollte.
Ich hätte da einen konstruktiven Vorschlag: Aufdoppelung bei den 3-4 notwendigen Querungen plus Speed-Bumps, und zwar richtige. Die Vorbilder findet man z.B. in Nairobi, die Afrikaner sind uns da einen Schritt voraus. Wer schnell drüber brettert, hat nachher entweder keine Plomben mehr im Mund oder ein kaputtes Auto. Oder beides. Plus Hinweistafeln: Achtung, Schrittgeschwindigkeit, Sie queren eine Begegnungszone!
Und dann schaut man, wie es sich entwickelt. Am Graben gibt es auch eine Querung und die funktioniert. Ich möchte das ideologiefrei diskutieren, denn es geht meiner Ansicht nach nicht darum den Bezirk autofrei zu bekommen, das ist sowieso eine Illusion. Es geht darum die notwendigen Fahrten zu erleichtern und die nicht notwendigen zu unterbinden, so einfach ist das Grundkonzept.
3.) Die Umbauten. Katastrophal geregelt. Wie ein Haus ohne Dach, in dem will auch niemand wohnen. Die Menschen bekommen in der Verkehrserziehung seit frühester Kindheite eingebläut, dass sie eine Fahrbahn nur mit eingeschaltetem inneren Warnsignal betreten dürfen. Und eine Fahrbahn erkennt man daran, dass sie wie eine Fahrbahn aussieht, und zwar unabhängig davon, ob da gerade etwas fährt. Das ist Verkehrspsychologie für Anfänger und die PlanerInnen der Mariahilfer Straße haben das entweder nicht gewusst oder geflissentlich übersehen. Die Menschen KÖNNEN dort nicht in Ruhe flanieren. Da rennt ständig die Alarmglocke: „Achtung, runter von der Fahrbahn, bevor was Schnelles, Großes daher kommt. Das ist verboten! Das ist gefährlich!“ Das ist anerzogen, ein notwendiger Reflex, gegen den man sich nicht einfach wehren kann indem man sagt: das ist jetzt erlaubt. Es sieht zwar super-verboten aus, aber es ist erlaubt.
Das funktioniert leider nicht.
Dazu noch ein Beispiel: Vor etlichen Jahren hat BMW einen Motorroller mit Dach gebaut. In dem war man angeschnallt und musste keinen Helm tragen. Für den Fall eines Unfalls war von BMW vorgesehen, dass die Fahrer die Beine am Trittbrett lassen und die Hände am Lenker. Dann gab es üble Verletzungen, weil der Mensch einen eingebauten Reflex hat, sich mit Händen und Füßen bei einem Sturz abzustützen. BMW wollte die Reflexe verbieten und ist damit gescheitert, das Projekt wurde wieder eingestellt.
Sie haben ein schönes Haus gebaut, nur leider ohne Dach. Und jetzt wundern sie sich darüber, warum niemand einziehen will.
Ohne Umbauten bleibt die Straße ein Gerippe ohne Fleisch.
4.) Das leidige Thema Radfahrer. Natürlich fahren die flott durch, ich würde das auch machen und habe es bei meinem letzten Besuch nur deswegen nicht gemacht, weil ich mir mantrahaft ständig „langsam, langsam“ vorgesagt habe. Das ist unnatürlich, weil die Fahrbahn ist eine Fahrbahn und sie ist breit und schön und die wenigen querenden Fußgänger stören nicht. Radfahrer sind so freie Strecken in der Stadt nicht gewohnt, sie müssen sich mit super schmalen Radwegen und fotografierenden Touristen herumschlagen sowie mit AutofahrerInnen, denen sie komplett egal sind, weil die in ihren hermetisch abgeschirmten Kisten gerade SMS tippen oder telefonieren oder laut Musik hören. Ich kann durch abgedunkelte Scheiben einen Radfahrer auch nicht sehen.
Also genießen sie die gerade, freie Strecke. Auch hier fehlen die Umbauten, die den Köpfen signalisieren: Achtung, das ist eine andere Art von Straße. Am Graben würde – wenn Radfahren dort erlaubt wäre und ich habe es schon ein paar Mal verbotenerweise probiert – niemand durchrasen, denn da rennen überall quer die Fußgänger hin und her. Die müssen auf Radfahrer auch nicht aufpassen und das ist gut so. Ich rolle dort langsam durch, nur einen Hauch schneller als ein Fußgänger, ungefähr so flott wie ein Jogger. Allen ist klar: der passt auf!
Vielleicht war das Konzept einmal gut. Aber dann haben die Bezirke hinein regiert und sonst noch einige Interessensgruppen. Und jetzt ist ein Gerippe da ohne Fleisch, ein Haus ohne Dach.
Wenn das nicht schleunigst repariert wird, besteht die Gefahr, dass das Konzept tatsächlich schief geht. Und das müssen die Grünen dann fressen, auch wenn sie jammern, dass sie nicht selbst Schuld sind, sondern die bösen Anderen.