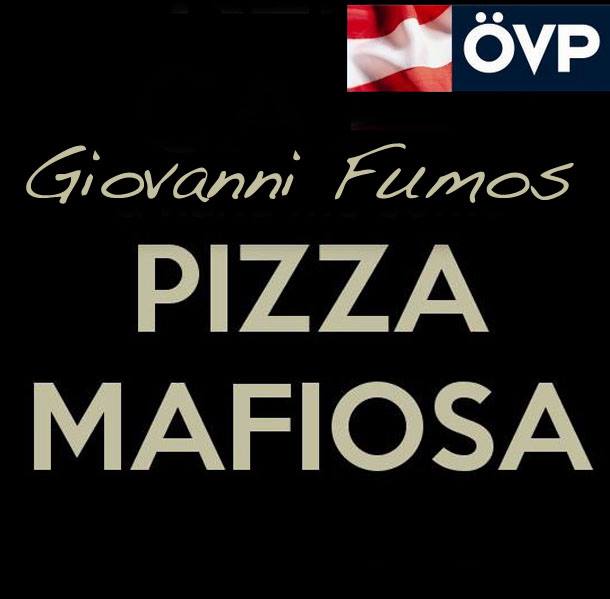Politik ist die Kunst der Gesellschaft. Menschen leben nur dann friedlich in Gemeinschaften, wenn ihre unterschiedlichen Interessen ausbalanciert werden. Diese Vermittlungstätigkeit nennt man meinem Verständnis nach „Politik“. Sie regelt das Zusammenleben der Menschen.
Ich habe ein Dutzend Gründe gefunden um mich politisch zu engagieren. Heute ist der erste Grund an der Reihe und er führt mich nach Afrika, genauer gesagt nach Äthiopien.
„Unser Volk leidet unter der Dürre. Immer mehr sehen sich gezwungen ihr Vieh um jeden Preis verkaufen zu müssen. Den Hirten geht es schlecht und ihre Tiere sind ebenfalls in keiner guten Verfassung. Doch wir haben nichts zu verkaufen außer unserem Vieh. Wer krank wird, kann sich nur so Medikamente besorgen. Wir verkaufen unsere Tiere, weil wir hungern. Uns bleibt keine Wahl.“
Das sagt ein hagerer Mann mit traurigen Augen, der gerade sein Vieh um einen Bettel in der Stadt verkauft hat. (Quelle: „Die Brunnen der Borana“, TV-Doku von Mario Michelini)
Doch was ist danach, wenn das Vieh und damit die einzige Lebensgrundlage weg ist? Der Klimawandel trifft Afrika besonders hart, da die Regenzeiten in den meisten Gebieten länger werden, manchmal jedoch auch ausbleiben, was zu unglaublichen Überschwemmungen samt enormer Erosion führt.
Bis vor nicht allzu langer Zeit haben die Borana als Viehhirten gelebt und hatten ein gutes, erfülltes Dasein. Die Trockenzeit und eventuelle Dürren konnten sie mit den „singenden Brunnen“ gut überstehen. Sie lebten seit Ewigkeiten in Einklang mit der Natur und ihren regionalen Besonderheiten. „Damals herrschte nicht so viel Hass und Missgunst“ meint ein anderer Borana.
Doch jetzt hat das Geld die Macht übernommen. Junge Menschen gehen zur Schule und interessieren sich nicht mehr für die Viehzucht. Immer mehr Borana sind auf internationale Hilfslieferungen angewiesen, um nicht zu verhungern.
Was geht uns das an? Schließlich sind wir ja nicht Schuld am Elend der Borana und anderer Völker. Und wir liefern denen dort ja ohnehin Hilfspakete.
Ist das wirklich so? Oder haben wir in unserer Gier und Maßlosigkeit einfach nur keine Rücksicht genommen und die Folgen unseres Handelns nicht betrachtet?
Wir konsumieren um den Preis des Elends anderer und fühlen uns auch noch im Recht. In Äthiopien gibt es nach wie vor viel fruchtbares Land, das die Bevölkerung und auch die Borana gut ernähren könnte. Doch das wurde den Menschen dort weggenommen, sie wurden einfach von korrupten Politikern enteignet und vertrieben oder umgebracht. Jetzt gehört das Land den Indern und Chinesen, die dort Monokulturen betreiben und die Waren exportieren. Nach China, in die USA und auch nach Europa. Zu uns, um es einmal klar zu benennen. Damit wir T-Shirts um 4,99 Euro bei H&M kaufen können – oder besser noch um 2,99 Euro.
Wir sind es, die dem hageren Mann keine Wahl lassen, nicht das Klima. Eine gesunde Kultur kann mit Klimawandel zurecht kommen, denn den gab es früher auch schon. Und dann regen wir uns furchtbar auf, wenn der hagere Mann vor dem entwürdigenden Leben und den Hilfslieferungen flieht. Dann beauftragen wir Frontex sein Boot zu versenken, damit er unser Land nicht erreicht. Und wir schicken ihn zurück, wenn er es doch schafft.
Ich finde das schlecht und maße mir damit ein Urteil an. Und ich will bei dieser Entwicklung nicht schweigen so wie die meisten. Daher engagiere ich mich bei der einzigen Partei, die mit ihrem Programm glaubhaft, wenn auch nicht oder noch nicht erfolgreich einen anderen Weg einschlagen will.
Ich bin dafür die Ausbeutung Afrikas zu stoppen. Ich empfinde es nicht als Menschenrecht, dass man sich jede Woche eine neue Kiste mit Modeartikeln von Zalando schicken lassen kann. Ich empfinde es jedoch sehr wohl als Menschenrecht, dass man in seinem eigenen Land sauberes Wasser erhält und sich selbst ernähren kann. Wer sich selbst das Recht heraus nimmt, der nimmt es anderen Weg.
Das Zeug von Zalando (stellvertretend für viele Konsumartikel) ist nicht billig. Es zahlt nur jemand anderer den Preis. Vielleicht der hagere Mann der Borana, dessen Augen genauso traurig sind wie die der KundInnen von Zalando. Wären sie es nicht, dann müssten sie nicht jede Woche was Neues kaufen.
Die Borana betreiben seit Jahrhunderten die „singenden Brunnen“. Das sind große, tiefe Brunnen, aus denen die jungen Männer mit Eimern das Wasser nach oben in einer Kette weiterreichen. Sie singen dabei, um sich die schwere Arbeit zu erleichtern. Hirten aus nah und fern kommen zu den Brunnen und dürfen dort ihre Tiere tränken. Für die Borana ist das Wasser aus ihren Brunnen für alle da.
Nun versiegen die Brunnen langsam und man hat einen neuen, motorgetriebenen Brunnen gebaut. Dort gibt es Zank und Streit und jeder denkt nur mehr an sich und sein Wasserbedürfnis. Zudem sind die Borana jetzt von Treibstofflieferungen abhängig, für die sie kein Geld haben.
In einer Welt, in der fast überall das Wasser privatisiert wird, sollten wir uns überlegen, ob das der richtige Weg ist. Oder ob wir Wasser nicht als ein Menschenrecht ansehen sollten, als Garant und Bedingung für eine funktionierende Gesellschaft.
Ich jedenfalls finde, dass dem so sein sollte und so fällt es mir nicht schwer zu entscheiden, welche politische Kraft ich daher unterstützen muss und will.
Daher meine politische Forderung Nr. 1: Dinge, die Menschen zum Leben brauchen, sollten nicht in der Verfügungsmacht bzw. im Besitz einiger weniger sein.